
H. P. Berlage
Time alters fashions. . . but that which is founded on geometry and real science will remain unalterable.
Dieses Motto wählte der englische Möbeltischler Sheraton für seine Sammlung Entwürfe, "the cabinet maker", welches Buch in der Mitte des 18. Jahrhunderts herauskam. Man sollte meinen, dass ein derartiges Motto für ein wissenschaftliches Werk, also für ein technisch künstlerisches, bestimmt wäre und nicht für ein solches über Möbel. Trotzdem betrachte auch ich das Motto Sheratons als richtig und wage es ebenfalls zu dem meinigen zu machen, gerade weil es eine Betrachtung über Kunst und zwar über Baukunst betrifft. Denn es gilt nicht, wie Sie vielleicht meinen könnten, den eigentlich wissenschaftlichen Teil der Baukunst, die Festigkeitslehre, sondern ihrer künstlerischen Teil, also die Formgebung in ihrem ganzen Umfange. Ich bin nämlich zu der Ueberzeugung gekommen, dass die Geometrie, also die mathematische Wissenschaft, für die Bildung künstlerischer Formen nicht nur von grossem Nutzen, sondern sogar von absoluter Notwendigkeit ist. Schon in früher gehaltenen Vorträgen hatte ich Gelegenheit zu erörtern, dass man nur über Prinzipien streiten kann, dass aber der Streit über die Frage "ob schön oder nicht schön", über die nüchterne Schönfinderei, bekanntlich schon vonden Römern als hoffnungs betrachtet wurde. Nun ist es zwar selbstverständlich, dass bei irgend welcher Beurteilung der individuelle Geschmack immer ein grosses Gewicht in die Schale werfen wird oder wie Hegel es ausdrückt: "Es bleibt ewig der Fall, dass jeder Mensch Kunstwerke oder Charaktere, Handlungen und Begebenheiten nach dem Masse seiner Einsichten und seines Gemüts auffasst; und da jede Geschmacksbildung nur auf das Äussere und Dürftige ging, und ausserdem ihre Vorschriften gleichfalls nur aus einem engen Kreise von Kunstwerken und aus beschränkter Bildung des Verstandes und Gemüts hernahm, so war ihre Sphäre ungenügend und unfähig, das Innere und Wahre zu ergreifen, und den Blick für das Auffassen desselben zu schärfen." Aber es ist bis zu einem gewissen Grade sogar empörend, dass Geschmacksäusserungen ohne irgend welche Motivierung gegeben werden können, und dass das grösste Kunstwerk, mit einem "es gefällt mir nicht" von einem jeden herunter gemacht werden kann. Es sollte doch nicht erlaubt sein, dass ein Urteil vom "man in the street" die gleiche Berechtigung hat, als dasjenige eines Kunstverständigen, und dass schliesslich ein Künstler, ohne irgend welchen Grund, vom nämlichen Strassenbummler ausgeschimpft werden kann, einer Arbeit wegen, die erhaben ist über allem Irdischen. Nein, so etwas sollte nicht möglich sein - wir fügen aber sofort hinzu: "Das braucht auch nicht der Fall zu sein." Denn sogar auf einem höhern Plan, unter Künstlern selbst, sollten gewisse Schönheitsdifferenzen auszugleichen sein, und es dürfte nicht vorkommen, dass ohne entschiedene Präzisierung der eine lobt, was der andere tadelt; es sollte doch in letzter Instanz der Gegner zu dem Geständnis gezwungen werden können: "Das Werk gefällt mir zwar nicht, aber trotzdem muss ich gestehen, dass es Schönheitsqualitäten besitzt, dass es mir sogar imponiert; kurz und gut: ich erkenne darin das Werk eines Künstlers." Geht man nun der Ursache dieser Meinungsdifferenzen auf den Grund, dann kommt man zu der Ueberzeugung, dass eine gewisse Uebereinstimmung in den meisten Fällen nur dann möglich ist, wenn man nach dem "wie" fragen kann; indem man also die Diskussion nicht zu führen hätte über die Frage, wie ein Kunstwerk ohne weiteres aussieht, sondern wie die Formen zu Stande gekommen sind. Es würde schon viel gewonnen sein, wenn man dem Schimpfenden zurufen könnte; "Nun ja, es mag dir gefallen oder nicht, aber du solltest einmal studieren, wie das gemacht wurde, d. h. mit welcher Konsequenz die Formen durchgeführt sind. Du sollst dir einmal klar machen, mit welcher Logik der Aufbau sich aus dem Plan entwickelt hat, und mit welchem Talent die betreffenden Baumassen damit in Uebereinstimmung gebracht wurden. Aber nicht nur das, sondern du musst gestehen, dass auch die Verhältnisse vorzüglich und die Verzierungen mit grossem Verständnis angebracht und geschmackvoll durchgeführt sind. Kurz und gut, du musst zugeben, dass das ganze Bauwerk in allen seinen Teilen eine absolute Einheit zeigt." Wenn von einem Kunstwerk, wie auch sonst gestaltet, das gesagt und dazu der Beweis angeführt werden kann, dann steht es über dem ordinären Geschmack nicht nur, sondern ebenfalls über der sachverständigen Beurteilung; d. h. man möge denn für das Werk als solches keine Sympathie haben, aber tadeln darf man es in dem Falle nicht. Und schliesslich sollte ein Kunstwerk nur von diesem Gesichtswinkel aus beurteilt werden, und da der "Strassenbummler" zu diesem Gesichtswinkel niemals kommt, ist es ihm überhaupt nicht erlaubt, mitzureden. Denn das Schöne, sagt Kant, soll dasjenige sein, was ohne Begriff, als ohne Kategorie des Verstandes, als Objekt eines allgemeinen Wohlgefallens vorgestellt wird. Um das Schöne zu würdigen, bedarf es eines gebildeten Geistes; der Mensch, wie er geht und steht, hat kein Urteil über das Schöne, indem dies Urteil auf allgemeine Gültigkeit Anspruch macht. Nun soll aber die Frage beantwortet werden, wie denn ein Kunstwerk gestaltet sein muss, damit auch wirklich von einer Einheitlichkeit im obigen Sinne die Rede sei, damit in ihm jene "Einheit in der Vielheit" herrsche, welche als Endbedingung zu demjenigen vorhanden sein soll, was nichts anderes bedeutet als "Stil". Dazu stelle ich sofort zum Vergleich die Frage, was denn die Pflanze zu einem Kunstwerk macht, und dadurch der uns umgebenden Natur jene unerschöpfte Bewunderung verbürgt, und was schliesslich dem Universum die für uns Menschen unverstandene Erhabenheit gibt? Denn was die kristallisierten, schneegekrönten Felsenmassen uns so gewaltig erscheinen lässt, sind nicht die Erscheinungen als solche, denn diese können nur erregen, sondern es sind die Gesetze, denen das ganze Weltall unterworfen ist, nach welchen es sich gestaltet hat und sich fortwährend umgestalten muss, welche Gesetze uns vor Ehrfurcht schaudern machen, schaudern vor der Einheitlichkeit, mit der das Ganze organisiert ist und die die Unendlichkeit bis zu den unsichtbaren Teilchen durchdringt. Schon Semper sagt in seiner schönen "Prolyomena über den Stil" : "So wie nämlich die Natur, bei ihrer unendlichen Fülle doch in ihren Motiven höchst sparsam ist, wie sich eine stetige Wiederholung in ihren Grundformen zeigt, wie aber diese nach den Bedingungsstufen der Geschöpfe und nach ihren verschiedenen Daseinsbedingungen tausendfach modifiziert, in Teilen verkürzt oder verlängert, in Teilen ausgebildet, in andern nur angedeutet erscheinen, wie die Natur ihre Entwickelungsgeschichte hat, innerhalb welcher die alten Motive bei jeder Neugestaltung wieder durchblicken, eben so liegen auch der Kunst nur wenige Normalformen und Typen unter, die aus urältester Tradition stammen, in stetem Wiederhervortreten dennoch eine unendliche Mannigfaltigkeit darbieten, und gleich jenen Naturtypen ihre Geschichte haben, - nichts ist dabei reine Willkür, sondern alles durch Umstände und Verhältnisse bedingt." Es ist eben dieser letzte Satz "nichts ist dabei reine Wilkür", welchen ich besonders hervorheben möchte, und welcher darauf hindeutet, dass in der Natur alles an feste Gesetze gebunden; dass zwar innerhalb dieser Gesetze die Umstände alle möglichen Veränderungen und Verhältnisse hervorrufen, dass aber auch dieses nicht willkürlich, sondern nach denselben Gesetzen vor sich geht. Sind nun schliesslich nicht allmählich alle menschlichen, alle gesellschaftlichen Organisationen ebenfalls durch Gesetze gebunden; d. h. haben die Menschen nicht das Bedürfnis gefühlt, sich selber Gesetze zu schaffen, damit sie zu Gesellschaften, Gemeinden, Städten wachsen könnten, ohne welche Gesetze sie aber nichts erreicht haben würden, indem nur durch Organisation die sonst isolierten Kräfte sich zusammen finden, und nur dadurch im Stande sind, etwas Grosses, etwas Einheitliches zu Stande zu bringen? Ich zögere nicht, zu dieser Behauptung die bezügliche Parallele zu ziehen, zu bezeugen, dass auch bei einem Kunstwerke nichts reine Willkür sein darf, mithin das Ganze ebenfalls nach einem gewissen Gesetz gestaltet sein soll. Und indem nun diese Gestaltungsgesetze im ganzen Universum mathematischer Natur sind, soll auch ein Kunstwerk in Uebereinstimmung damit nach mathematischen Gesetzen gestaltet sein, d. h. was das Körperliche anbelangt, nach stereometrischen, und was die Fläche anbelangt, nach geometrischen. Denn sind nicht alle Himmelskörper Kugeln, die vollkommenste stereometrische Form, welche Kugeln aber durch Umstände zu Ellipsoiden wurden, zu Körpern, welche dennoch eine rein stereometrische Form haben. Durchstreifen nicht alle diese Himmelskörper in elliptischen d. h. geometrischen Bahnen den unendlichen Raum, mit den Sternenzentren genau in den Brennpunkten plaziert, indem ein physikalisches Gesetz eine solche Stelle fordert. Und werden diese Bahnen nicht durch besondere Umstände modifiziert, welche Umstände wiederum physikalischer Natur sind? Entwickeln sich nicht alle Pflanzen und Blumen nach geometrischen Gesetzen, so wie die Zergliederung der vegetabilischen Bildung durch den Durchschnitt der Samenbehälter, die Form der Blüten und Blätter, die Zwei-, Drei-, Vier- und Mehrblätterigkeit der verschiedenen Pflanzen auf die Kreisteilungsgesetze führt, aber mit tausendfachen Abweichungen, durch Umstände bedingt; und ist es nicht eben deswegen, dass wir gerade die Pflanzen für unsre ornamentale Kunst zum Vorbild nehmen? Treffen wir nicht in der ganzen Tierwelt Beispiele einer gesetzmässigen Entwickelung, mit festen Verhältnissen; ja die niedrigen Tiere sogar in geometrischen Figuren sich gestaltend, wie der Seestern und die Seerose, und gibt es nicht auch Tiere, welche sogar ihre Häuser nach streng geometrischen Formen bauen, wie viele Muscheltiere und Insekten? Wenn man das alles bedenkt und das Weltall von einem solchen Standpunkt aus betrachtet, wenn man also weiss, wie das Ganze, nach geometrischen Gesetzen aufgebaut und gestaltet ist, und man sogar von Gott als des Universums Baumeister spricht, alsdann sollte doch der Mensch nicht meinen, es für seine Werke ohne Gesetze fertig bringen zu können. Und das kann er auch nicht, weil jede Arbeit ohne Organisation, ohne Methode niemals zu einem befriedigenden Resultat führen kann. Und namentlich sollte man dies bei Werken der Architektur bedenken, indem doch das Weltall selbst mit einem architektonischen Gebilde verglichen werden kann. Ja, man kann sogar noch weiter gehen und behaupten, dass die Symmetrie, welche in allen Bildungen der Natur herrscht, auf gewisse ursprüngliche Bildungsgesetze hinweist, welche mit den Gesetzen der Geometrie, mit den geometrischen Grundformen der Vielecke, oder mit der Kreisteilung, völlig zusammen treffen; und wenn die Geometrie ihre Figuren "in abstracto" konstruiert, so finden wir in den wirklichen Naturbildungen gleichsam eine lebendige Geometrie; eine lebendig freie Schöpfung nach geometrischen Gesetzen. Dies geht aus der Zergliederung wirklicher Naturbildungen, vorzugsweise der Mineralbildung, hervor. Die Grundformen der Kristalle bestehen aus Vielecken, und auch hier finden wir das Drei- und Viereck als Primitivformen. So erscheinen als die Kernformen mancher Kristalle das Tetraeder, das aus vier gleichen, gleichseitigen Dreiecken besteht, die sechsseitige Säule, der aus sechs Quadraten bestehende Würfel, die quadratische Säule, die aus übereinander gesetzten Würfeln gebildet ist. Zugleich finden wir unter den Kernformen der Kristalle gewisse Modifikationen, die Enteckung und Entkantung, welche mit der Art der Grundformenbildung des gotischen Stils, mit der Abplattung oder Wegnahme der Ecken und Kanten, die auffallendste Aehnlichkeit haben. Auch darf nicht unberührt bleiben die in der Natur vorkommende Verwachsung zweier Kristalle mit einander, auf welche Erscheinung ich später noch zurückkommen werde, welche Verwachsung unseren Betrachtungen den grössten Wert verleiht, indem sie ebenfalls zu Vergleichen führt. Aber auch bei der Schöpfung seiner Kunstwerke, es möge wie ein Paradox klingen, braucht der Mensch der Gesetze feste Führung; er hat sie nötig, um zu etwas Vollkommenem gelangen zu können. -
Betrachten wir nun die Sache etwas näher, dann stellt sich heraus, dass unser Verlangen in dieser Richtung gewissermassen als eine Reaktion gegen die herrschende Gesetzlosigkeit zu betrachten ist; gegen die absolute Willkür in der Kunst, eine Ansicht, welche bis jetzt als die einzig richtige, als die allein künstlerische gegolten hat. "Die Kunst soll frei sein!" ist die Meinung, welche als absolut unanfechtbar gilt; sofort wenn man ihr Schrauben anlegt, ist es mit der Kunst fertig! -
Man fragt sich nun, vorher diese Meinung kommt, und ob sie berechtigt ist. Diese Meinung, und es ist nicht das erste Mal, dass das betont wird, kommt von den Malern oder vielmehr von der Malerei her, von der, wie bekannt, bis jetzt noch so ziemlich die Ansicht gilt, dass sie unter den bildenden Künsten eigentlich die einzige Kunst sei; für die Skulptur will man zuguterletzt noch diese Ansicht gelten lassen. Dass aber die Architektur eine Kunst sei, ist eine übertriebene Wertschätzung. Sie mag vielleicht früher einmal eine Kunst gewesen sein, aber für heutzutage ist sie das nicht mehr. Daher hat nun die Malerei, d. h. die Staffelmalerei, als die einzige sogenannte freie Kunst, einen solchen Einfluss erlangt, dass alle Künste gleichermassen unter diesem Einfluss gelitten haben; ein Zustand, der schon von der Renaissancezeit datiert. Das Wort "malerisch" ist ein Zauberwort geworden in dem Sinne, dass jeder Schutthaufen auf einen Künstler und auch auf das irregeführte Publikum eine grössere Anziehungskraft auszuüben pflegt, als ein architektonisches Gebilde, und sei es noch so erhaben; und ein Bildchen mit einer Kuh neben einem Bächlein auf eine höhere Sympathie rechnen kann, als etwa die Wandmalereien eines Giotto oder eines Michelangelo. Diese Wertschätzung hat die freie Kunst, die gesetzlose Malerei, auf ihrem Gewissen. Und wie gesagt, es kamen die Skulptur und die Architektur auch dermassen unter diesen Einfluss, dass Bildhauer und Architekten in malerischer Richtung zu arbeiten anfingen. Die Skulptur machte malerische Gruppen, und die Architektur malerische Gebäude, je nach dem persönlichen d. h. absolut willkürlichen Geschmack des betreffenden Künstlers. Man verstehe mich gut; nicht das Malerische als solches soll bestritten werden, denn unter einem höheren Gesichtspunkt der Wertschätzung sind ein griechischer Tempel und ein gotischer Dom ebenfalls malerisch, sondern die Auffassung des malerisch Gefälligen, durch die Landschaftsmalerei entstanden, wie ja diese Spezialisierung ebenfalls erst von der Renaissancezeit herrührt. Und namentlich für die Architektur kam bei dieser Ansicht die allerschlimmste Zeit. -
Denn von dem Moment an, wo sie den Weg des rein Willkürlichen betritt, ist es um sie geschehen. Abgesehen noch von der schon erwähnten Tatsache, dass die Architekten malerisch zu bauen anfingen, eine Art, welche sich durch alle möglichen überflüssigen Umbauten, Türmchen, Erkerchen und lieblichen Eckchen auszeichnet, fingen sie nebenbei an, Wert auf malerische Zeichnungen zu legen, wobei dann das eigentlich Architektonische in den Hintergrund gedrängt wurde. -
Ihre Entwurfzeichnungen, die doch schliesslich nur Mittel und nicht Zweck sind, mussten wie Gemälde aussehen, und die perspektivischen Zeichnungen erst recht; eine Ansicht, welche noch dermassen vorherrscht, dass sie vergangenen Sommer auf dem Architektenkongress in Londen noch von einem deutschen Architekten verteidigt wurde. Als man sich nämlich beklagte, dass bei Architekturausstellungen die Säle leer blieben, und nach Mitteln gesucht wurde, dem Publikum mehr Verständnis für Architektur beizubringen, gab der betreffende Architekt den Rat, noch schönere Zeichnungen zu machen. Ich habe diesen Standpunkt bestritten, indem man m. E. alsdann erst recht auf verkehrte Wege geraten würde. Das Publikum würde in dem Fall nicht hingehen, um die Architektur verstehen zu lernen, sondern der Gemälde wegen; und in der Absicht, ein Gemälde zu geben, dafür ist eine architektonische Zeichnung nicht geschaffen, so schön sie auch gezeichnet sein mag. Denn eine solche Zeichnung kann mit einem Gemälde ja doch nicht konkurrieren, und das soll sie auch nicht. Das wäre so ungefähr dasselbe, als wenn man das Publikum zu einer Ausstellung von musikalischen Kompositionen einladen und versuchen wollte, die Notenschrift so schön wie möglich herzustellen. Nein, wenn das Publikum eine architektonische Zeichnung nicht versteht und nicht gefällig findet, was man nebenbei ganz gut begreifen kan, soll es wegbleiben. Erst wenn es am Gebäude selbst, d. h. am eigentlichen Kunstwerke die Architektur zu verstehen gelernt hat – wie die Musik bei Aufführung einer Symphonie und nicht aus der Notenschrift - kommt es vielleicht nachher dazu, sich auch die Entwurfzeichnungen mit Verständnis anzusehen, sowie es einem Kenner Genuss verschafft, die Partitur eines Musikstückes durchzulesen. Und wieviel Unheil schliesslich die malerischen Architekturzeichnungen schon gestiftet haben, beweisen noch täglich Konkurrenzen, wobei sogar die auserwählten Preisrichter sich durch schöne Zeichnungen verführen lassen und Preise ausreichen, welche den weniger "flott", d. h. weniger malerisch gezeichneten, aber architektonisch mehrwertigen Projekten hatten zukommen sollen. Also von dem Moment an, wo die Architektur das Gebiet der sogenannten freien Kunst betrat, war es mit ihr aus. Diese Behauptung klingt wie ein Paradox, und nach den allgemein geltenden Begriffen über Kunst, unkünstlerisch: die Kunst, so heisst es, soll mit Gesetzen nichts zu tun haben; nur das Gefühl allein soll herrschen und die Formen diktieren. Trotzdem kann man ruhig dazu die Gegenbehauptung aufstellen, dass die Kunst nicht nur einem Gesetz untergeordnet sein soll, sondern in dem Fall sogar zu einer höhern Aeusserung gelangt. Und das gilt nicht nur für die Architektur, bei der man eher zu dieser Ansicht geneigt sein dürfte, weil sie, ihrem Wesen nach, mit der Wissenschaft zusammen hängt, sondern es gilt ebenfalls für die beiden Schwesterkünste, die Skulptur und Malerei, deren Gestaltungen ebenso wenig nach reiner Willkür geschaffen, sondern ebenfalls gewissen Gesetzen unterworfen sein sollten, und zwar um eine höhere Aeusserung möglich zu machen. Hegel sagt: "Die Kunst aber, weit entfernt die höchste Form des Geistes zu sein, erhält in der Wissenschaft erst ihre echte Bewährung. -
Ihre wahre Aufgabe ist, die höchsten Interessen des Geistes zum Bewusstsein zu bringen. Hieraus ergibt sich sogleich nach der Seite des Inhalts, dass die schöne Kunst nicht nur könne in wilder Fessellosigkeit der Phantasie umherschweifen; denn diese geistigen Interessen setzen ihr für ihren Inhalt bestimmte Haltepunkte fest, mögen die Formen und Gestaltungen auch noch so mannigfaltig und unerschöpflich sein. Das Gleiche gilt für die Formen selbst. Auch sie sind nicht dem blossen Zufall anheim gegeben. Nicht jede Gestaltung ist fähig der Ausdruck und die Darstellung jener Interessen zu sein, sie in sich aufzunehmen und wieder zu geben, sondern durch einen bestimmten Inhalt ist auch die ihm angemessene Form bestimmt." Man bemerkt schon, dass diesen Betrachtungen zufolge innerhalb einer Architekturkomposition, nach dieser Auffassung für das Staffeleibild, also für das Gemälde, wie wir es kennen, kein Platz ist; d.h. dass es nur unter den günstigsten Umständen, in einer solchen Gesamtkomposition geduldet werden kann. Staffeleibild und Salonfigur haben sich allmählich der künstlerischen Gemeinschaft entzogen. Wenn sie wieder aufgenommen werden wollen, werden sie sich den Gesetzen der Gemeinschaft unterwerfen müssen; und wenn das nicht freiwillig geht, dann soll's mit Zwang geschehen. Aber geschehen muss es; denn das ist das einzige Mittel, wieder zu einer höheren Baukunst, d.h. zu einem Stil zu geraten, da es in letzter Instanz ein Stil ist, den wir wieder erreichen wollen, und ein solcher ohne Gesetz nicht gedacht werden kann. Wie heisst nun das Gesetz, oder die Gesetze, welche der Kunst zu Grunde gelegt werden müssen? In einem Vortrag "Gedanken über Stil", welchen ich in einigen deutschen Städten hielt, habe ich versucht klar zu legen, dass jene Eigenschaft, durch die sich die alten Monumente, man nehme sie aus irgend welcher Stilperiode, von den heutigen unterscheiden, die "Ruhe" sei; dass diese Ruhe wieder eine Folge von Stil und dieser Stil wiederum eine Folge sei von "Ordnung" d.h. von einer gewissen methodischen Entwurfskunst. Der bezügliche Satz lautet: "Wie gelangen wir nun wieder zu einer "Einheit in der Vielheit", zu dieser allgemein bekannten Eigenschaft des Begriffs Stil?" -
Es ist kein Rezept dazu da, das auf einmal wieder neu entdeckt werden und darauf Genesung bringen könnte. -
Nein, es führt ein langer Weg von Kunstexperimenten erst zum Ziel. Man studiere die Natur im allgemeinen, in dem Sinne wie ich es oben meinte, also, wie ich Ihnen schon sagte, ihren Gesetzen nach, und im besondern, also in unserm Falle, die alten Monumente, nicht um sie zu imitieren, oder von ihnen detaillierte Motive abzunehmen, (darauf werde ich noch näher zurückkommen), sondern um jene Elemente in ihnen aufzusuchen, die ihnen Stil gegeben haben. -
Und fällt dabei nicht sofort auf, dass das Urprinzip des Stils "Ordnung" ist, d.h. Regelmass, sogar dort, wo sie scheinbar nicht vorhanden ist, ja sogar dort, wo es nicht sogenannte akademische Pläne gibt, wo wir also nichts mit Symmetrie im gewöhnlichen Sinne des Worts zu tun haben? -
Es ist kein Zufall, dass wir von klassischen Ordnungen reden, oder dass sogar in einzelnen Sprachen Befehl und Ordnung ein und dasselbe Wort sind. So wie in der Natur Ordnung herrscht, indem sie nach festen Gesetzen arbeitet, eben so gut sehen wir eine gewisse Ordnung in den alten Monumenten. Unsere Architektur sollte daher auch wieder nach einer gewissen Ordnung bestimmt werden. Wäre demnach das Entwerfen nach einem gewissen geometrischen System nicht ein grosser Schritt vorwärts? Eine Methode, nach welcher viele der modernen niederländischen Architekten schon arbeiten? Das was ich in jenem Vortrag nicht näher erörtern konnte, hoffe ich jetzt zu tun. Um jedoch jedem Misverständnis sofort vorzubeugen, soll folgendes beachtet werden. Diese Methode, welche eine geometrische Grundlage zu jedem Entwurf voraussetzt, soll selbstverständlich nur Mittel und nicht Zweck sein; die künstlerische Idee gehe ihr voran. Denn man kommt doch immer wieder darauf zurück, was Eitelberger von Edelberg in seinen gesammelten kunsthistorischen Schriften sagt: dass wahre Kunst sich nicht machen lässt nach Regeln, weder in der Musik, noch in der Poesie, noch in der Architektur; aber, heisst es am Schluss, sie setzt ein Erkennen der grossen einfachen Gesetze voraus. Nun denn; es sind diese einfachen Gesetze, welche die Formen kontrollieren, und namentlich die Verhältnisse näher bestimmen sollen, welche sonst unkontrollierbar, d. h. nur individuelle Geschmackssache, und daher absolut willkürlich sind. Diese Gesetze sollen dem absoluten Schwanken, zwischen dem "so oder so" so viel wie möglich vorbeugen und endlich einmal ein bestimmtes Wissen an die Stelle des ewigen Zweifels setzen. Denn warum soll die bildende Kunst nicht dasselbe tun, was in der Musik und Poesie als selbstverständlich gilt? Kann man sich eine musikalische Komposition ohne bestimmte Tonart und Takt, ein Gedicht ohne Silbenverhältnisse und Strophenrhythmik vorstellen? Warum soll die Architektur, jene Kunst, welche so oft mit der Musik verglichen wird, eine Tatsache, die Schlegel zu dem bekannten Ausdruck "gefrorene Musik" geführt hat, ohne rhythmische d. h. geometrische Gesetze komponiert werden? Ist doch der Rhythmus ein Gesetz, eine Ordnung der Zeitfolge, wie Lemke sagt, und könnte man demzufolge nicht noch weiter gehen und sogar behaupten, dass absolut willkürlich komponierte Architektur keine Architektur sei? Eine Ansicht, welche näher bestätigt wird durch Reichensperchers Ausspruch, in der Einleitung zu dem Büchlein von Roriczer über die filiale Gerechtigkeit, dass "der Gedanke eines jeden wahren Kunstwerkes, seinem letzten Grunde nach, wesentlich mathematischer Natur, seine obersten Gesetze die Gesetze der Mathematik sind." Wird die künstlerische Idee dadurch eingeschraubt, angekettet? Ebenso wenig, wie die musikalische Idee durch die Tonart eingeschraubt wird oder die poetische durch die rhythmische Uebertragung. Im Gegenteil, diese Form ist eine charakteristische, eine conditio sine qua non. Sie ist eine Schönheitsbedingung, ohne welche das Tonwerk kein Tonwerk, das Gedicht kein Gedicht wäre. Ist nun die Folgerung gewagt, dass ein Architekturwerk ohne eine solche Rhythmik eben so wenig ein Architekturwerk sei? Das Schönste von allem ist aber die Tatsache, dass dieses Verlangen nach einer architektonischen Rhythmik nichts Neues bedeutet. Ich erwähnte in dem nämlichen Vortrag, dass jenes System mit dem Modull der klassischen Kunst einerseits, und mit dem mittelalterlichen Dreiecksystem andererseits zu vergleichen ist. Da haben wir's; was bei den Alten ebenfalls selbstverständlich war, das haben wir, wie denn in der Architektur alles verschwunden ist, was an ihre frühere Herrlichkeit erinnert, gänzlich verloren, nämlich Stilarchitektur zu treiben. Denn wie machen wir's, wenn wir noch historisch arbeiten? Dann kopieren wir gedankenlos die alten Formen, und mit ihnen auch die bezüglichen Verhältnisse; wenn wir einen klassischen Portikus vor ein Gebäude setzen, holen wir uns wieder einmal den Vitruv hervor, um unsre Modull- und Parteserinnerungen noch einmal aufzufrischen; aber wir beschränken uns, was diese Verhältnisse anbelangt, auf den Portikus, indem wir für die übrigen Gebäudeteile keine Vorlagen haben; oder, wenn wir einen Paladianischen Bau herstellen, sind wir durch die Säulenverhältnisse auch an die Stockwerkhöhen gebunden und kopieren die für uns nicht mehr lebendigen Formen mit den zwar bekannten Säulen- und Gesimsverhältnissen, aber wir arbeiten, was die Fassadenteile des Gebäudes betrifft, ganz willkürlich, indem wir dafür keine Normen haben. Die Griechen haben schon, als etwas Selbstredendes, ihre Tempelbauten nach einer festgesetzten Norm aufgeführt, und letztere verdanken unzweifelhaft diesen Normen ihre wunderbare Schönheit und ihren Stil. Wir wissen durch Vitruv, dass die griechischen Tempel nach allgemeinen Gesetzen des Modull zusammengestellt waren, und dass dieses Verhältnis nach der Bestimmung des Gebäudes variiert, indem für Tempelgebäude, als Gotteshäuser, nicht, bei profanen Gebäuden aber der menschliche Mastab als Grund genommen wurde. Es haben sogar Alberti, Barbaro, Blondel, Brisena, u. a. behauptet, dass die Gebäude der Griechen und Römer nach harmonischen Verhältnissen aufgebaut waren. "L'Idée, sagt Charles Chipiez, d'établir un parallèle entre la musique et l'architecture est séduisante. Juste quand la comparaison ne dépasse pas de certaines limites, cette idée devient fausse dès qu'elle tend à persuader que les proportions des sons et celles des formes ont des lois identiques. Cette théorie à conduit d'ailleurs à des résultats surprenants; on a découvert dans les trois principales dimensions du Parthenon "le grand accord composé de l'unisson (la hauteur); de la double tierce (la largeur) et de la double quinte (la longueur) et ainsi de suite pour toutes les autres proportions de ce temple." Das alles wissen wir nun ganz genau, ja sogar schon aus der Bibel, dass die Arche Noahs 6 mal länger als breit war, und dass Höhe und Breite sich verhielten wie 1 : 5, und dass die Masse der Gegenstände im Salomonischen Tempel ein einfaches Verhältnis hatten. Und wenn man als junger Student anfängt, Architektur zu studieren, ist das Studieren der Säulenordnungen auch das allererste; aber auch in dem Sinne das allerletzte, als man weiterhin von möglichen gesetzmässigen Verhältnissen nichts mehr zu hören bekommt. Mit dieser sehr unvollkommenen Kenntnis soll man auskommen; unvollkommen: denn nun erfährt man, dass die Hauptverhältnisse der griechischen Tempel sich in einfachen Zahlen ausdrücken liessen, wie denn einfache Verhältnisse immer einen grossen Reiz auf den Menschen ausüben. Ein solches einfaches Verhältnis nannten die Griechen Symmetrie. Schon bei Aristoteles findet man, dass die Griechen unter Symmetrie das einfache, und dadurch leicht ins Auge fallende gegenseitige Massverhältnis der verschiedenen Teile eines Gegenstandes begriffen; und Vitruv versteht unter Symmetrie die Zahlenzusammenstellungen, welche die Höhenverhältnisse, die Gesimsdispositionen, ihr gegenseitiges Verhältnis u. s. w. bestimmen, während wir heutzutage unter Symmetrie etwas ganz anderes verstehen. Fergusson schreibt über die griechische Architektur in seiner "History of Architecture" folgendes: "The system of definite Proportion, which the Greeks employed in the design of their temples, was a cause of the effect they produce even on uneducated minds. It was not with them merely, that the height was equal to the width, or the length about twice the breadth; but every part was proportioned to all those parts, with which it was related, in some such ratio as 1 : 6, 2 : 7, 3 : 8, 4 : 9 or 5 : 10 etc. We do not quite understand the process of reasoning, by which the Greeks arrived at the laws, which guided their practice in this respect; but they evidently attached the utmost importance to it, and when the ratio was determined upon, they set it out with such accuracy, that even now the calculated and the measured dimensions, seldom vary beyond such minute fraction, as can only be expressed in hundredths of an inch. Though the existence of such a system or ratio, has long been suspected, it is only recently, that any measurements of Greek temples have been made with sufficient accuracy, to enable the matter to be properly investigated, and their existence proved, the ratios are in same instances so recondite and the correlation of the parts at first sight, so apparently remote, that many would be inclined to believe, they were more fanciful than real. It would, however, be as reasonable in a person with no ear, or no musical education, to object the enjoyement of a complicated concerted piece of music, experienced by those differently situated, or to declare that the pain musicians feel from a false note, was mere affection. The eyes of the Greeks were as perfectly educated as our ears. They could appreciate harmonies, wich are lost in us, and were offended at false quantities, which our duller senses fail to perceive. But in spite of ourselves, we do feel the beauty of these harmonic relations, though we hardly know why; and if educated to them, we might acquire what might almost be considered as a new sense. But be this as it may, there can be no doubt, but that a great deal of the beauty which all feel in contemplating the architectural production of the Greeks, arise from causes, such as these, which we are only now be going to appreciate." Ganz oberflächlich wird nun die Existenz solcher griechischen Hauptverhältnisse angedeutet; das übrige soll man aus den Vorlagen selber ersehen. Aber auf die grosse Wichtigkeit dieses ganzen Modullsystems als solches, eventuell für die ganze Baukunst, wird nicht hingedeutet, und von einer eventuellen weiteren Entwickelung, ist natürlich gar nicht die Rede. Man betrachtete diese Wissenschaft als gänzlich verloren, und wenn man noch vielleicht eine Ahnung davon hatte, wurde doch kein weiterer Wert darauf gelegt. Jedoch "gar leichtiglich verlieren sich die Künste, aber schwerlich und durch lange Zeit, werden sie wieder erfunden" bemerkt schon Dürer in seiner Vorrede zu der im Jahre 1525 in Nürnberg gedruckten "Unterweisung der Messung, mit dem Zirkel und Richtscheydt, in Linien ebnen und ganzen Corporen." Und so wird es auch jetzt wieder gehen, denn eine solche Kunst hat nicht nur im klassischen Altertum gelebt, und demzufolge auch in der Renaissance, obgleich sie daselbst nicht in dem Masse Verwendung gefunden; nein, auch in der mittelalterlichen Kunst soll ein vollkommenes, geometrisches System als Grundlage zu den architekturalen Kompositionen gegolten haben. Ich sage soll, denn von allgemeiner Bekanntheit scheint das nicht zu sein, obgleich in letzter Zeit eifrige Versuche in dieser Richtung gemacht wurden, um das sogenannte "Hüttengeheimnis" zu entdecken. Denn es ist kaum denkbar, dass jene Kunst, welche in ihrem ganzen Wesen eine geometrische Gestaltung zeigt, d. h. welche in ihren architektonischen Formen und Verzierungen so deutlich den Zirkel und das Richtscheit zu erkennen gibt, in ihren Verhältnissen willkürlich und nicht ebenfalls nach festen Regeln bestimmt worden wäre. Gehen wir noch früher zurück als zur griechischen Kunst, zur ägyptischen, so ist uns zwar davon nicht viel bekannt, aber es ist nicht gewagt, aus den grossen mathematischen Kenntnissen des ägyptischen Volkes und aus dem Charakter ihrer Kunst den Schluss zu ziehen, dass zur Bildung der letzteren die Geometrie jedenfalls nicht fremd gewesen. Untersuchungen haben nachgewiesen, dass das ägyptische Dreieck, also der Pyramidenschnitt mit dem Verhältnis von 8 Basislängen zu 5 Höhenlängen, nach einer ganzen "archäologischen Schule" sogar "der Schlüssel aller Verhältnisse, das Geheimnis aller wirklichen Baukunst" sein soll. Man meint ebenfalls, in einzelnen Pyramidenbauten, den Goldenen Schnitt, nämlich als Verhältnis der halben Basis zur Hypothenuse, nachgewiesen zu haben. Zwar reden Müller und Matties in ihrem archäologischen Wörterbuch von diesen Sachen als von einem für Kunst und Architektur oft "sehr ernst empfohlenen Blödsinn", aber bei Pythagoras spielt dieser Schnitt eine grosse Rolle, und Kepler hat ihn sogar mit einem Edelstein verglichen. Wie dem auch sei: die neueren Untersuchungen führen zu dem Schluss, dass eine Absicht hinter den Verhältnissen dieser gewaltigen Monumente wie der ägyptischen Pyramiden stecken muss, und diese Meinung wird verstärkt dadurch, dass in der Königskammer der Cheops-Pyramide das Osiris, Isis und Horus geweihte Dreieck mit dem Verhältnis 3 : 4 : 5, also dasjenige des Pythagoras, zurückgefunden wurde. Und Dr. Petri schreibt: "The most probable theory of its construction of Cheops is, that it was of such an angle that the height was the radious of a circle, equal to the circuit of the base. This is so exactly the case that it can hardly be questioned." Und auch die Untersuchungen von persischen Monumenten, u. a. von Dieulafoy, brachten einige interessante Ergebnisse zu Tage. Er schreibt über eine Kuppelkonstruktion "Quelle ne fut pas ma surprise, en constatant que les rayons de courbure, la position des centres, en un mot, tout le tracé de l'anse de panier, dérivait de l'employ du triangle rectangle, si fameux dans l'antiquité égyptienne, dans lequel les côtes sont entre eux comme les nombres 3 . 4 . 5." Dieses Dreieck, also nicht das eigentlich ägyptische, kann bei vielen persischen Kuppelkonstruktionen nachgewiesen werden. Es scheint mir nun von Interesse, von diesen verschiedenen Verhältnissystemen Kenntnis zu nehmen, und indem das griechische Modull-System als von allgemeiner Bekanntheit vorausgesetzt werden darf, das mittelalterliche aber so wie das der Ägypter und Perser nicht, so will ich von letztern Ihnen einige Beispiele vorführen: Wie ich schon hervorhob und es nicht genug wiederholt werden kann, bedeutet eine solche geometrische Grundlage nur Mittel, nicht Zweck. Da wir aber wissen, dass die Griechen sich eines solchen bedient haben, wird man wohl nicht mehr den Mut haben, es als unkünstlerisch vorzustellen und eventuell dessen Benutzung zu verwerfen. Nur mache man sich recht klar, dass die geometrische Grundlage allein noch nicht den Künstler macht, weil die künstlerische Idee durch die Geometrie nicht gezeugt wird. Nichtkünstler können mit jenem System nichts, Künstler mit ihm alles machen, in der Voraussetzung, dass sie das Mittel beherrschen und nicht dessen Sklave werden. Es ist wie eine Waffe in Händen von Kindern und Erwachsenen; im ersten Fall ist es eine Gefahr; im zweiten eine höhere Leistungsfähigkeit. Verschiedene Studien der mittelalterlichen Architektur haben gezeigt, dass die Baumeister der romanischen und gotischen Dome die Mathematik und zwar die Geometrie zur Bestimmung der Verhältnisse zu Hülfe genommen, anfangs für die Lösung ihrer Grundrisse, später auch für die Bestimmung der Aufrisse, und dass dabei das Dreieck und das Quadrat eine Hauptrolle gespielt haben. Das Hüttengeheimnis vom gerechten Steinmetzengrund von Dr. von Drach, Professor an der Universität zu Marburg, berichtet darüber folgendes: Aus zwei Schriften von G. Dehio, Professor der Kunstgeschichte an der Universität zu Strassburg, "Untersuchungen über das gleichseitige Dreieck als Norm gotischer Bauproportionen", Stuttgart 1894 und "Ein Proportionsgesetz der antiken Baukunst und sein Nachleben im Mittelalter und in der Renaissancezeit", Strassburg 1895, sind diese Zeugnisse aus alter Zeit für die damals in Uebung gewesene Triangulation zu erwähnen. Aus ihnen geht hervor, dass etwas an der Sache ist, d. h. dass im Mittelalter der Triangel tatsächlich als Norm für die Proportionierung gedient hat. Ferner erläutert Cesare Cesariano, der Verfasser der Vitruvübersetzung (Como 1521), den Begriff der "Orthographia" an dem Beispiel einer Grundriss- und Querschnittzeichnung des Mailänder Domes, wobei er ausführt, dass sie nach der "deutschen" d. i. gotischen Regel trianguliert seien. Allein Cesarianos Angaben sind bekanntlich von der jüngern Generation der Kunst- und Bauforscher einmütig verworfen worden. Man hielt sich durch den herrschenden Begriff der künstlerischen Freiheit dazu verpflichtet, indem man also argumentierte: "Ein echtes Kunstwerk kann ohne Freiheit nicht geschaffen werden; die gotischen Kirchen sind echte Kunstwerke, folglich können sie nicht trianguliert sein, und folglich ist auch die Angabe Cesarianos unglaubwürdig oder mindestens ohne allgemeine Bedeutung." Diese unglaublich oberflächliche und ohnehin noch auf den Kopf gestellte Beurteilung, ebenfalls wie ich schon hervorhob, durch die allgemein herrschende Meinung über die sogenannte Freiheit in der Kunst hervorgerufen, wurde aber trotzdem durch ein 1875 erschienenes vollkommen authentisches Dokument von bedeutend höherem Alter zuschanden gemacht. Gleich im Anfangsstadium des Mailänder Dombaues entstand nämlich zwischen den einheimischen Architekten und den aus Deutschland berufenen ein heftiger Streit. Unter den Sachverständigen, deren Superarbitrium man einholte, befand sich der Piacentiner Gabriel Stornaloco, "expertus in arte geometriae". Von diesem rührt die beistehend in verkleinertem Facsimile (nach Beltramie) wiedergegebene Zeichnung her, mit dem Datum 1391. Das erste Geschoss ist nach dem Schema des Kölner Doms proportioniert, d.i. drei neben einander gestellte, gleichseitige Dreiecke bestimmen einerseits die Gesamtbreite der fünf Schiffe, andererseits die Höhe der ersten Kämpferline. Die weitere Entwickelung erfolgt nach einer anderen Idee als in Köln, aber immer streng triangulatorisch. Inwieweit die wirkliche Ausführung dem Schema Stornalocos entspricht, vermag ich, da mir eine zuverlässige Querschnittaufnahme nicht zur Hand ist, nicht zu sagen. Das zweite Dokument ist ebenfalls unanfechtbar. Es ist ein auf den Bau von S. Petronio in Bologna bezüglicher, im Jahre 1592 als Kupferstich veröffentlichter Riss. Der Bau von S. Petronio, in den ersten Vorbereitungen 1388 begonnen, und bestimmt, die grösste gotische Kirche nicht nur Italiens, sondern der Welt zu werden, war im Laufe des 15. Jahrhunderts in Stockung gekommen; gegen Ende des 16. entschied man sich, nach den zahlreichen Projekten, die für den Ausbau umsonst aufgestellt waren, für die Vollendung, wenn auch in verkürzter Gestalt. Ausser dem Querschiff und Chor, die definitiv aufgegeben wurden, fehlten noch die Hochwände und Gewölbe des Mittelschiffs. Hierüber entspann sich ein unter leidenschaftlicher Teilnahme der Bevölkerung geführter Streit. Die eine Partei verlangte, dass die ursprünglich beabsichtigte, der "deutschen" d.i. gotischen Regel des gleichseitigen Dreiecks, entsprechende Höhe beibehalten werde; die andere, an deren Spitze der leitende Architekt Perribilia, wollte, teils aus dem bekannten Hass der Renaissancekünstler gegen den gotischen Stil als solchen, teils aus wirklich stichhaltigen Gründen die Gewölbe niedriger haben, und diese blieb, wenn auch mit einigen Zugeständnissen, Sieger. Auf unserem Kupferstich nun gibt ein nicht näher bekannter Architekt, Siriano Ambrosino, eine Parallele, wie er in der Beischrift ausführt, zwischen den neuen und den trianguliert gewesenen Gewölben. Ausserdem enthält die Beischrift die Behauptung, alle alten Teile seien trianguliert gewesen. Leider liefern die drei Nachrichten, als schon der Zeit des Niederganges angehörig, nicht den Beweis, dass in Deutschland zur Blütezeit der Gotik eben dieselben Regeln der Triangulation gegolten haben; sie lassen uns darüber im Unklaren, wann und wie die Methode erfunden oder entstanden sei. Nehmen wir nun die verschiedenen Untersuchungen zusammen, dann ergibt sich daraus, dass die sogenannte Triangulation warscheinlich aus Zweckmässigkeitsrücksichten zunächst in der Praxis benutzt worden sein mag, ohne jegliche Gedanken an ihre ästhetische Wirkung, die daher erst später entdeckt worden ist. Diese Triangulation ergibt sich sofort aus dem einfachen praktischen Verfahren, eine Senkrechte auf fixe Gerade zu errichten, also einen rechten Winkel zu konstruieren. Aus des Meisters Lorenz Lachers, der Pfalz Baumeister und Pixenmeister, im Jahre 1516 für seinen Sohn Moritz niedergeschriebenen "Unterweisungen und Lehrungen, sein Handwerk desto besser und künstlicher zu vollbringen" kennen wir das im späten Mittelalter, bei der sogenannten Orientierung übliche Verfahren, durch die einfache Konstruktion eines rechten Winkels. Auf Grund einer solchen Voraussetzung ergibt sich aber die prinzipielle Idee zur Verwendung von (gleichseitigen) Dreiecken als Normen für die Disposition der Kirchen-Grundrisse auf einfache und natürliche Weise. Aus einem gleichseitigen Dreieck ergibt sich aber, dass das Verhältnis der Höhe zur Basis eine inkommensurabele Zahl ist, nämlich bestimmt durch V 3. Zeigt sich daher, wie das so oft konstatiert werden kann, dass in einem Bau zu einander senkrechte Dimensionen, die mit der bei seiner Konstruktion zu Grunde gelegten Masseinheit nicht ganzzahlig gemessen werden können, oder wenigstens in einem einfachen Verhältnis zu einander stehen, so weist dies sofort darauf hin, dass ihre Proportionierung nicht auf arithmetischer Grundlage erfolgt ist, und das hätte doch auf der Hand gelegen; sondern, dass man geometrisch konstruierend dabei vorgegangen ist, möglicherweise triangulatorisch, d. h. mit Anwendung von gleichseitigen Dreiecken. Aus diesem Vorgang kann man auch die vielen Abweichungen erklären, die man an mittelalterlichen Bauten zu konstatieren vermag. Aus der Zusammenstellung zweier Dreiecke ergibt sich das sogenannte Pythagoräische Hexagramm, und aus der Konstruktion der Höhenlinien in einem Dreieck und der Verbindung ihrer Fünfpunkte die eigentliche Triangulation, indem alle Punkte dieser Figur für die Konstrukion brauchbar sind.


Die bei weitem wichtigste Anwendung des gleichseitigen Dreiecks für die mittelalterliche Architektur bestand aber in der Herstellung von triangulierten Rechtecken. Neben dem Triangel kommt als bedeutendste Figur das Quadrat in Betracht, und daher neben der Triangulation die Quadratur. In der einfachen Form, d. h. bei dem Gebrauch des Quadrats und der Verbindung der Seitenmittelpunkte entstehen zwei Reihen konzentrischer Quadrate, welche aber jedesmal die halbe Grösse haben und daher für den Gebrauch keinen Erfolg bieten. Die Quadratur gewinnt erst an Bedeutung, wenn dabei auch die Schwenkung vorgenommen wird, so dass zwei gleichgrosse Quadrate zum Achtort verbunden sind. Aber auch hierbei ist es nicht der Umstand, dass jetzt die beiden oben genannten Teilungen sich zu einer Skala als geometrische Progression mit dem Exponenten 1 : V2 vereinigen, sondern es liegt die Bedeutung darin, dass sich ein langgestrecktes gleichschenkliges Dreieck bildet, auf welches sich eine sogen.

Dass man, bevor eine in dieser Art prinzipiell einheitliche Durchführung gelang, zunächst nur den Versuch gemacht haben wird, in den Aufrissen des Kirchenäussern an einzelnen Stellen Triangulierung zu benützen, ist selbstverständlich. Jedoch beweist der Dom von Paderborn, dass auch schon vor dem Fritzlarer Bau die Architekten bestrebt gewesen sind, in ihren Entwürfen noch einen Schritt weiter zu gehen wie da, indem sie nicht nur durchweg ein und dieselbe Konstruktionsmethode benutzten, sondern den ganzen Aufriss in einer geometrischen Grundfigur, die in vorliegendem Fall ein durch Doppeltriangulation über der Gesamtbreite erhaltenes Rechteck (S x 2 p), abgibt, hinein komponierten; in ganz ähnlicher Weise, wie dies auch bei der Grundrissbildung üblich geworden war, wie bei Lippoldsberg durch ein Netz von Quadraten. Die St. Elisabethskirche zu Marburg, im J. 1235 begonnen, wird in der Beschreibung der Baudenkmäler im Regierungsbezirk Cassel, nächst der Liebfrauenkirche zu Trier, das älteste unter den reingotischen Bauwerken Deutschlands genannt. Sie zeigt eine in anbetracht der langen, oft unterbrochenen Bauzeit wunderbare Einheit des Planes und der Ausführung.
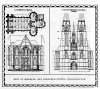
Jedoch zeigt die Triangulierung, dass diese bezüglich des Bauplanes ein anderes Resultat ergeben; sie beweist, dass die vielgerühmte Harmonie, wonach das Ganze wie aus einem Guss hergestellt erscheint, insofern nicht besteht, als die Turmfront im Anschluss an die während ihrer Bauzeit, die gegen Ende des 13. Jahrhunderts beginnt, zur Herrschaft gelangte


Die schon obengenannte St. Elisabethskirche zu Marburg ist ein Beispiel dafür, dass man bei genauer Untersuchung der Triangulation mittels gleichseitiger Dreiecke anfangs meinen sollte, mit einer Nachlässigkeit beim Bau zu tun zu haben; welche sich im Gegenteil nachher als eine Folge der grossen Genauigkeit herausstellt, mit der der Plan zur Ausführung gelangte; als eine ganz korrekte Durchführung einer wohldurchdachten, lediglich auf Anwendung der Triangulation mit gleichseitigen Dreiecken fussenden Disposition. Auch der Querschnitt der Schiffe ist vollständig mit dieser Triangulatur hergestellt, und zwar teilweise mit der in der französischen Frühgotik benutzten Triangulationsmethode, wobei als Basis die Lichten Weiten zwischen den Pfeilern erschienen. Der Bau-Anlage hat demnach, soweit bis jetzt untersucht worden ist, das gleichseitige Dreieck als Proportionsnorm gedient. Bei den Türmen und den Fassaden wurde, wie bereits erwähnt, dieses Verfahren aufgegeben und die
Ja, man könnte die Frage stellen, ob nicht gerade deswegen diese beiden Stile die konstruktivsten gewesen sind, und daher eine so grosse Uebereinstimmung zeigen, trotzdem sie eine absolut verschiedene Formensprache haben und sich geistig diametral gegenüberstehen. Beweist dies aber nicht, dass es in der Kunst ewige Gesetze gibt, die die Vorbedingung aller formalen Schönheit und daher unabhängig von allen Geistesströmungen sind? Beweist dies nicht, dass ohne Verwendung dieser Gesetze von einer stilvollen Architektur nicht die Rede sein kann, indem sie sonst ein Produkt der reinen Willkür wäre, d. h. Gesetzlosigkeit, eben nicht die wahre Freiheit, sondern Schrankenlosigkeit und daher Armut; dass dagegen Gebundenheit die wahre Freiheit und daher Reichtum bedeutet. Denn es ist nicht wahr, dass Gesetzlosigkeit die Phantasie, die Einbildungskraft, jene künstlerische Göttergabe, fördert. Im Gegenteil, man entdeckt die Unendlichkeit der Formenvariationen erst recht bei vorher bestimmtem System, gerade wie die Natur bei ihrer unendlichen Fülle doch sehr sparsam in ihren Mitteln ist. Beweisen nicht eben die orientalischen Völker, deren unglaubliche Phantasie in Ornamentformen wir bewundern, die Notwendigkeit eines solchen Systems, indem sie selbst, infolge ihrer Erfindungskraft in der Bildung geometrischer Figuren so viel Erstaunliches geleistet haben? Haben die Araber nicht eben deswegen ihre ornamentalen Kompositionen mit einem Linienornament durchwoben; und würden sie ohne dieses das geleistet haben, was uns jetzt mit Bewunderung erfüllt? Und gibt es nicht zu denken, dass die Japaner und Chinesen, deren Kunst, namentlich die der erstern, uns bewundernswert erscheint, (welche Kunst sich aber fast ausschliesslich nach der malerischen Seite, nach der Seite der freien Kunst entwickelt hat) keine monumentale Architektur besitzen und leider jetzt anfangen mit schlechten europäischen Vorbildern ihre Städte zu verderben. Die Tatsache allein, dass wir wissen, dass in den alten Zeiten nach einer gewissen Methode gearbeitet wurde, sollte Anregung genug sein, wenigstens auch nach einer Methode zu arbeiten, und das gerade in einer Zeit, die sich vorzugsweise, und mit Recht, die wissenschaftliche nennt, und daher danach streben sollte, auch in der Kunst etwas mehr wissenschaftlich vorzugehen. Denn wie gesagt, das bedeutet keineswegs etwas Unkünstlerisches; denn Kunst und Wissenschaft stehen einander nicht feindlich gegenüber, im Gegenteil, sie sind von derselben Mutter geboren. Und namentlich ist das bei der Architektur der Fall, welche Kunst die Wissenschaft braucht, um zur höheren Entwickelung gelangen zu können. Durchdringen sich doch schon mehr und mehr die Baukunst des Ingenieurs und des Architekten, Berufe, die früher auch nicht dermassen getrennt waren wie jetzt. In meinem letzten Vortrag über die wahrscheinliche Entwickelung der Architektur, im vorigen Winter hier in Zürich gehalten, hatte ich auch schon Gelegenheit dies hervorzuheben, indem ich zum Schluss sagte, dass in der Zukunft gebaut werden wird, einerlei was, ein Haus oder eine Halle, eine Fabrik oder ein Tempel, von einem Menschen, der einen Namen führen wird, einerlei welchen, der aber keinen Zweifel mehr an dem Beruf eines derartigen Kulturmenschen übrig lassen wird. Ja nun, dieser möge denn im allgemeinen Baumeister heissen; nur habe ich damit sagen wollen, was ich jetzt wiederhole, dass in der Zukunft Wissenschaft und Kunst sich wieder dermassen ergänzen werden, dass ein architektonisches Kunstwerk beider Resultat sein wird. Und ich wiederhole, in jedem Fall soll dieses architektonische Kunstwerk nach einem gewissen geometrischen Schema entworfen sein; eine Methode, welche sicher eine höhere Kunstform verbürgt, als die für gewöhnlich übliche, die willkürliche; "un malheur aujourd'hui dans les arts, - sagt Viollet-le-Duc - et particulièrement dans l'architecture, c'est de croire qu'on peut pratiquer cet art sous l'inspiration, de la pure fantaisie, et qu'on élève un monument avec cette donnée très vague, qu'on veut appeler le gôut, comme on compose une toilette de femme". Und ein gültiges Argument kann sogar aus dem Begriff des Stilisierens im allgemeinen genommen werden. Wenn wir Naturformen stilisieren, dann bedeutet das deren Uebertragung innerhalb fixierte Grenzen, eine Festlegung nach Linien, die in der Natur schon vorhanden waren, aber mit Vernachlässigung jeder Zufälligkeit durch die Umstände bedingt. Bedeutet das aber nicht ebenfalls eine Formgebung nach geometrischen Gesetzen? Und weshalb soll das nur mit Ornamenten und nicht mit architektonischen Formen geschehen? Im Gegenteil, erst dann kann von einer Stilarchitektur im wahren Sinne die Rede sein, wenn damit übereinstimmend auch die Architektur stilisiert erscheint. Denn ist in letzter Instanz eine Fassade nicht ebenfalls eine ornamentierte Fläche? Kommt es nicht darauf an, Fenster, Gesimse, Skulpturen u.s.w. wie ein Ornament auf die Mauerflächen zu verteilen? Und ist ein Gebäude nicht zu vergleichen mit einem in der Natur in streng stereometrischen Formen vorkommenden Kristall, d. h. mit einem Gebilde von Kristallen, daselbst aber mit Abweichungen, durch die Umstände bedingt? Und kommen wir daher nicht der Natur gleich, indem wir nach ihrem Vorbilde streben, nach der Vervollkommnung unserer architektonischen Gebilde, wie doch schon Ägypter, Griechen, Byzantiner, Römer und die europäischen Völker im Mittelalter mehr oder weniger ernsthaft in ähnlicher Weise getan, und daher Resultate erzielt haben, die wir nicht erreichen können? Kommt uns ein ägyptischer oder griechischer Tempel nicht vor wie ein erhabenes Gebilde, völlig vom Irdisch-Stofflichen losgelöst, und stimmt uns nicht immer und immer wieder ein mittelalterlicher Dom zur Ehrfurcht, weil er sich durch den Stoff aus dem Stoff losgerungen hat. Wie ekelhaft nüchtern, wie grenzenlos trocken, wie beschämend geistlos sind dagegen unsre modernen Gebilde, und namentlich die Gebäude, die demselben Zwecke dienen sollen. Weshalb? -
Ich will jetzt nicht die religiöse Seite berühren, d. h. inwiefern die mehr oder weniger in den Gemütern lebende Religion den Charakter der kirchlichen Architektur beeinflusst, aber jedenfalls bleibt jene Ursache die wahrscheinlichste, dass an den Gebäuden die Stilformen nur als solche angebracht, ihnen als eine äusserliche Hülle angehängt worden sind, dass aber jener Architektur der innere Geist fehlt, weil sie nicht wie früher, nach festen harmonischen Regeln aufgebaut wurde. Es ist nichts anderes als ein Wahn, aber dennoch scheint man der Meinung zu sein, man schaffe ein Werk z. B. im gotischen Stil, wenn man ein solches Werk mit sogenannter gotischer oder spitzbogiger Verzierung versehe. Diese ist aber nur die äussere Schale; der innere Kern besteht in der Konstruktion der Grundformen, die geometrischen Figuren entnommen sind. *)
*) Und da nun in der Architektur die Verzierung, das Ornament absolut Nebensache, die Raumbildung und Massenverhältnisse aber die Hauptsache sind, so ist infolgedessen leicht einzusehen, wo der Fehler steckt.
Und das ist nicht nur mit kirchlichen, sondern mit allen unsern modernen Gebäuden der Fall, und für diese letzteren gilt nicht der mehr oder weniger starke religiöse Einfluss. Jene Gebäude beweisen nur, wie viel, oder richtiger, gesagt, wie wenig das Schönheitsgefühl allein nützt, ohne nähere Kenntnis der Regeln, nach denen die alten Meister gearbeitet haben. Wenn solche Karrikaturen wie die meisten unserer modernen gotischen Dome vermieden werden sollen, dann ist es notwendig, auf die Regeln der alten Meister zurückzugehen, und den Faden da wieder anzuknüpfen, wo er am Ende des fünfzehnten oder im Anfang des sechzehnten Jahrhunderts abgerissen wurde. Wenn aber diese Regeln, nach welchen die Alten arbeiteten, (da niemand Steinmetzmeister werden konnte, wenn er nicht nach diesen Regeln Modelle angefertigt hatte) so Herrliches geschaffen haben, dann wird man zugestehen müssen, dass die in diesen Steinmetzmeisterstücken und Meisterzeichnungen enthüllte Arbeitsweise der alten Werkmeister ein grösseres Gewicht hat, als die moderne Ansicht einzelner, die sich gegen eine streng geometrische Konstruktion der Bildungen der gotischen Architektur wie gegen einen unerträglichen Zwang sträuben und nicht zugeben wollen, dass die Formen, die allerdings durch das künstlerische Gefühl frei hervorgerufen werden sollen und müssen, doch erst durch die geometrische Begründung sowohl ihren festen Halt in sich als auch eine harmonische Uebereinstimmung mit den Teilen, denen sie angehören, erlangen. Und in der Tat, wenn heutzutage ein Architekt sich unterstehen würde ohne geometrische Hülfsmittel ein gotisches Gebäude zu errichten, käme er sofort vor die grösste Schwierigkeit zu stehen. Und obgleich bis jetzt, soviel ich weiss, noch nicht festgestellt wurde, inwiefern auch profane Gebäude aus früheren Stilperioden nach festen geometrischen Regeln gebildet worden sind, darf man doch annehmen, dass das ebenfalls der Fall gewesen, indem doch immer, und namentlich im Mittelalter, der Einfluss der kirchlichen auf die Profan-Architektur so stark gewesen, dass wahrscheinlich die baulichen Regeln, die zur Herstellung der ersteren dienten, jedenfalls für die Bildung verschiedener Bauteile an profanen Gebäuden benutzt wurden, und die Grundriss-Einteilung wahrscheinlich auch, obgleich diese viel schwieriger zu lösen ist, weil abhängig von mehr komplizierten praktischen Bedingungen. Ich erwähnte übrigens schon ein Beispiel Viollet-le-Ducs in dieser Richtung. Wie dem auch sei, ich hoffe Ihnen zur Genüge dargelegt zu haben, dass ein Entwerfen nach bestimmten Regeln nicht nur empfehlenswert, sondern zur Bildung wirklicher stilvoller Architektur eine Notwendigkeit ist. Wie das geschehen soll? So wie die Natur zur Bildung ihrer Kristalle schon selbst die einfachen geometrischen und stereometrischen Figuren für sich in Anspruch genommen hat und in früheren Stilperioden in ähnlicher Weise gearbeitet worden ist, und weil schliesslich diese Figuren von unveränderlicher Schönheit sind, empfiehlt es sich, von neuem bei unsrer Allmutter in die Lehre zu gehen. So wie schon Hegel bei seiner Einteilung der Künste, was das sinnliche Material betrifft, behauptet, dass die Architektur die Kristallisation bedeutet, so gibt auch dieser Ausspruch die bezügliche Anregung. Wie wir gesehen haben, arbeiteten die mittelalterlichen Meister vorzugsweise mit dem gleichseitigen Dreieck, der daraus erfolgten Triangulatur und den triangulierten Rechtecken. Also im geometrisches Verfahren im Gegensatz zur griechischen Kunst, welche nach arithmetischen Grundsätzen verfuhr. Aber da die Geometrie und die Arithmetik Schwestern sind, bleibt das Prinzip dasselbe. Die mittelalterliche Kunst kam zu diesem Verfahren, indem das harmonische Prinzip von innen nach aussen wirkte. Die Griechen, leidenschaftliche Bewunderer der äusseren Form, arbeiteten nicht immer in dieser Weise, wohl aber die Römer in ihren überwölbten Bauten and Basiliken. Wir sehen am griechischen Tempel eine auswendige Ordnung, nach einer wunderbaren Harmonie entworfen, aus der aber die innere Proportionsskala nicht herzuleiten ist. Im Mittelalter, und das ist wohl die grosse Errungenschaft dieser Kunst, kommt das römische Prinzip zur vollen Geltung, dass der äussere Aspekt nichts anderes sein soll als die Hülle der inneren Zusammenstellung und mithin die innere Proportion auch diejenige der äusseren sei. Der Raum soll proportioniert werden und seine Proportionen auswärts zeigen. Denn die Architektur hat den Zweck, Räume zu bilden, und soll daher vom Raum ausgehen. Und jede Absicht, erst eine schöne Fassade zu bilden und nachher das Gebäude dahinter zu komponieren, ist absolut verwerflich. Nun hat zu diesem Zweck das geometrische Verfahren, die Triangulation und die daraus erfolgenden triangulierten Rechtecke, den Vorzug. Einen Schritt weiter bringt die sogen. Quadratur, die sich aus zwei übereck gestellten Quadraten ergibt, mit der daraus entwickelten sogen.

Bei uns hat ein Architekt mit Namen de Groot sich von neuem für die Sache interessiert und, nachdem er die alten Urkunden, namentlich Hoffstadts Gotisches A. B. C. Buch studiert, selbst ein Werkchen herausgegeben, das interessante Beiträge zu diesem Gegenstand enthält. Er zog dabei ein Schriftchen zu Rate, das sogen. Hüttengeheimnis vom rechten Steinmetzen Grund, von Dr. Alhan v. Drach, das einige Jahre früher herauskam. Schon im Jahre 1896 erschien von de Groot ebenfalls eine Studie, die sich auf das Flachornament bezieht, unter dem Titul "Dreiecke beim Entwerfen von Ornamenten". Er zeigt darin, wie unendlich viele Variationen in bezug auf rhythmische Flächeneinteilung mit den gewöhnlich gebrauchten Dreiecken zu erzielen sind. Diese Einteilungen bilden gewissermassen den Stramin, auf welchem die Ornamente angebracht werden müssen, bilden schon selbst eine Ornamentik. Aber prinzipiell sollen sie eine Anregung zur ornamentalen Bildung sein, mit dem auch wirklich überraschenden Resultat, dass sich unendlich viele Ornamentmotive wie von selbst daraus ergeben. Diese Methode ist also gerade umgekehrt, d. h. indem man erst die Fläche rhythmisch einteilt und nachher das Ornament hineinzeichnet; im Gegensatz zu der gewöhnlich befolgten, wobei man zuerst eine Form der Natur entnimmt und sich nachher dazu den Rhythmus, die Stilisierung sucht. Wer etwas schaffen will, darf nicht direkt entlehnen. Man soll Motive wachsen lassen und alles anbringen, was zur Flächenteilung nötig ist. Eine solche Argumentierung hat etwas für sich und besonders, weil es Ornamente gibt, die nicht ihr Vorbild in der Natur haben und deswegen auch künstlerisch eine höhere Bildungsstufe vergegenwärtigen, als die der Natur entlehnten. Ich erwähne diese Methode, weil sie zur Ergänzung einer vollständigen architektonischen Komposition dienen kann. Die ersten Beispiele aus dem oben erwähnten Werkchen stimmen überein mit den Ihnen vorhin gezeigten aus mittelalterlichen Aufrissen, die nächsten aber sind von mehr Nutzen, da sie auf der bekannten Quadratur basieren und zeigen, wie ein Körper in seinen Verhältnissen gänzlich aus einer solchen geometrischen Figur entnommen werden kann; d. h. wie infolge der Uebereckstellung von Quadraten und der Ergänzung dieser Figur durch die parallelen Kreise, die durch deren Schnittpunkte gezogen sind, ein progressives System entsteht, mit dem bekannten Verhältnis? 1 :ü2, woraus sich die Grundriss- sowie die Aufrissmasse ergeben; daraus folgt, dass Grund- und Aufriss durcheinander gezeichnet werden können, was natürlich nicht nötig ist, aber den Beweis liefert, wie innerhalb dieses Systems Grund- und Aufriss einander gewissermassen durchdringen, und daher eine grosse Harmonie zwischen beiden existieren muss. Diese Methode empfiehlt sich besonders für alle möglichen freistehenden Gebäudeteile und Gegenstände, sowie für kunstgewerbliche Sachen, und speziell für Töpferwaren und Geschirr. Aber auch für Möbel zeigt eine solche Methode sich von grossem Nutzen, was ich Ihnen an ein paar Beispielen von mir zeigen werde. Erstens an einem Stuhl. Der Sitz eines Stuhles kann mit ganz kleiner Modifikation in einem Kubus konstruiert werden; nimmt man daher das bekannte Höhenmass eines Stuhles, nämlich ± 43 cm, als das Mass des Grundquadrats an, dann ergibt sich die vordere Breite, sowie die Tiefe ebenfalls als 43 cm. Die hintere Breite, gewöhnlich schmäler als die vordere, ergibt sich sowieso aus der Figur, gerade so wie die sonstigen feinen Modifikationen aus den verschiedenen Kreisen, und Punkten, die in der Figur enthalten sind. Für Gegenstände, höher als die Diagonale des Grundquadrats, kann man mehrere Quadrate übereinander stellen, wie z. B. für den Stuhl, wobei man gerade mit zwei Quadraten auskommt. Ein zweites Beispiel giebt ein Büffetschrank, wobei zwei Quadrate nebeneinander, und vier übereinander gestellt sind.

Selbstverständlich gehört Uebung und Geschmack dazu, von einer solchen Figur den richtigen Gebrauch zu machen, so wie man allmählich zu der Entdeckung gelangen muss, welche Punkte man gebrauchen soll, und welche nicht. Man wird aber dann sehr bald bemerken, welche grosse Bequemlichkeit eine solche Methode verschafft, nicht nur zur Bestimmung der Masse und Verhältnisse allein, sondern sogar der Verzierung, die sich aus der Figur wie von selbst ergibt und daher in logischem Zusammenhang damit steht. Mit Verzierung ist natürlich alles gemeint, die zugehörige Linienführung, in die das Ornament hineinkomponiert werden kann. Es ist doch deutlich ersichtlich, wie harmonisch das Quadrat durch die progressiven Quadrate und Kreise eingeteilt ist, aus welcher Einteilung sich sofort eine Flächendekoration ergibt; und indem die nämliche Quadratur sich auf den Flächen des Gegenstandes befindet, kann man von dieser Teilung für Verzierungszwecke den Gebrauch machen, der vom persönlichen Geschmack eingegeben wird. Und gerade bei dem Gebrauch der Quadratur wird man erst recht sehen, dass die Phantasie, anstatt eingeschränkt, gefördert wird und man zu Lösungen kommt, an die man sonst nicht gedacht haben würde. Das erreicht man aber auch nur dann, wenn man sich, wie gesagt, klar zu machen versteht, dass man nicht der Sklave eines solchen Systems werden soll, d. h. wenn man nur von denjenigen Linien Gebrauch zu machen weiss, die das Gefühl angibt, das künstlerische Talent fordert, und wenn man, sagen wir ganz offen, jenes System an den Stellen zu verlassen weiss, wo das Gefühl, das Talent, sich allzueng fühlen möchte, da das Gefühl schliesslich Gründe haben kann, die der Verstand nicht begreift. Und gerade für Flächeneinteilung, um darauf noch einmal zurück zu kommen, zeigt die rhythmische Progression sich so ausserordentlich bequem und harmonisch, dass es sich für ein Flächenmuster, ich denke an Fussböden, Wandfliesen u s. w. vorzüglich eignet.
Ich sagte oben schon, dass erst dann Stil in ein architektonisches Werk hineinkommt, wenn nicht nur die grosse Massenverteilung, sondern auch die Details nach denselben System gebildet werden, wie z. B. im Mittelalter, aber auch erst in der mittleren und späteren gotischen Periode, während man in der ältern selbstverständlich in der Verzierung zuerst noch eine blosse Naturnachahmung wahrnimmt. Aber nachher gab es keine Laubverzierung, die nicht wie jede Masswerk-Verzierung auf eine geometrische Grundfigur sich zurückführen liesse. Ahnt man jetzt nicht, dass in einer solchen Methode im allgemeinen der Keim zur Erreichung dieser "Einheit in der Vielheit" liegt, die Stil heisst, eben weil man dadurch zu einem einheitlichen Grundprinzip kommt, von wo aus das Ganze sich nach einer festen Skala entwickelt. Es mögen noch einige Beispiele von de Groot folgen; eine Säulenkomposition, aus welcher deutlich zu ersehen, wie die Verzierung des Kapitäls schon im Grundrisse festgelegt und daher logisch stilrichtig entwickelt und aufgebaut ist. Das folgende Beispiel ist eine klassische Säulenordnung, - obgleich es nun absolut nicht feststeht, ja es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Renaissancemeister in irgend einer ähnlichen Weise gearbeitet, sondern vielmehr die klassischen Modullverhältnisse für ihre Schöpfungen zu Rate gezogen haben, so ist doch aus diesem Beispiel deutlich ersichtlich, dass diese Methode in vorzüglicher Weise darauf anwendbar ist.


Ein anderes Beispiel zeigt einen viersäuligen Aufbau, wobei man sofort die Projektion übereck, d. h. nach der Diagonale, studieren kann, eine äusserst wirksame Konsequenz, weil man in gewöhnlichen Fällen nicht leicht zu einer solchen Betrachtung kommt. Zum Schluss die Methode an einer klassischen Triumphpforte. angewandt. Obgleich ich Ihnen jetzt verschiedene Beispiele alter Monumente vorgeführt habe, an denen Triangulatur und Quadratur nachweisbar waren, und von den griechischen ein arithmetisches Proportions-Gesetz authentisch ist, jedoch an diesen Monumenten verschiedene Säulenverschiebungen, ungleiche Lichte Weiten u. s. w. vorkommen, die nur aus Gefühlserwägungen erklärt werden können, so bleibt trotz alledem noch unsicher, ob in der Tat die Absicht von vornherein feststand, die alten Monumente bis in die kleinsten Details nach einem einheitlich geometrischen Ganzen zu bilden, ungeachtet der schon erwähnten Systemänderungen während der langen Bauzeit. Aber nun frage ich, was wäre dagegen, wenn wir für die jetzt kommende Zeit feststellen sollten, dass eine architekturale Komposition nur dann Anspruch auf eine solche erheben kann, wenn sie bis in das kleinste Detail nach einem einheitlich geometrischen System gebildet wäre, denn ich darf annehmen, dass das bis jetzt entweder gar nicht oder nur in sehr unvollkommener Weise, und dann nur in der Stilarchitektur, nach der klassischen Modulation stattgefunden hat. Mir ist wenigstens von ausländischer Architektur, ich rede jetzt als Holländer, nichts davon bekannt. Wohl darf ich annehmen, dass Sie mit vielem von dem, was ich jetzt anführte, vertraut sind, aber ich bezweifle, ob eine ähnliche Methode von Ihnen bei Ihren Kompositionen verwendet worden ist. Ist das trotzdem der Fall, dann mögen diese Auseinandersetzungen um so mehr eine Anregung sein, in dieser Richtung fortzufahren ; wenn nicht, dann mögen sie eine Anregung sein, damit anzufangen. Denn ich wiederhole: was wäre dagegen einzuwenden, nach all dem Vorhergegangenen eine solche Methode wiederum als Mittel zu benutzen. Aber als Mittel und auch nur als Mittel, was ich noch einmal betonen möchte, und zwar im allgemeinen, will heissen: indem die Geometrie selbst aus wenigen Grundformen unendlich viele Variationen und Verhältnisse ermöglicht, wie schon aus der Natur ersichtlich, so soll auch jede Aufgabe für sich nach einem besonderen, dafür passenden Verhältnis gelöst werden, umsomehr als es kein System gibt, das für jeden besondern Fall passt. Das erheischt Studium und Übung, aber ebenfalls Geschmack. "L'Architecture, sagt Viollet-le-Duc, n'est pas l'esclave d'un système hieratique de proportions, mais au contraire, peut se modifier sans cesse et trouver des applications toujours nouvelles, des rapports proportionnels, aussi bien qu'elle trouve des applications variées à l'infini des lois de la géometrie; et c'est qu'en effet les proportions sont filles de la géometrie, aussi bien en architecture que dans l'ordre de la nature inorganique et organique". Nur Mittel, denn auch Hegel warnt schon in der Kunst davor, zu viel Wert auf Zahlenverhältnisse zu legen, ein Ausspruch, den ich ohne Kommentar wiedergebe. Er sagt: "Allerdings ist zur Zeit der schönsten Blüte der gotischen Baukunst den Zahlensymbolen grosse Wichtigkeit beigelegt worden, indem die noch trübere Ahnung der Vernünftigen leicht auf die Äusserlichkeit fällt; doch werden die Kunstwerke der Architektur durch solcherlei immer mehr oder weniger willkürliche Spiele einer untergeordneten Symbolik weder von tieferer Bedeutung noch von erhöhter Schönheit, da ihr eigentlicher Sinn und Geist sich in ganz anderen Formen und Gestaltungen ausspricht, als in der mystischen Bedeutung von Zahlenunterschieden. Man muss sich deshalb sehr hüten, in Aufsuchung solcher Bedeutungen nicht zu weit zu gehen, denn allzugründlich sein und überall einen tieferen Sinn deuten wollen macht ebenso sehr kleinlich und ungründlich als die blinde Gelehrsamkeit, die auch an der klar ausgesprochenen und dargestellten Tiefe, ohne sie zu fassen, vorübergeht". Das sind immerhin goldene Worte. Zum Schluss füge ich hinzu: Sie soll nur Mittel bleiben, denn wenn man die Absicht spüren würde, würde der Glaube fehlen. Ich bin absichtlich etwas weitläufig gewesen, da ich bei Ihnen die Ueberzeugung habe wecken wollen, dass, was auch geschehen sein möge, jedenfalls etwas in dieser Richtung geschehen ist, und dass es für die zukünftige Architektur, will diese wieder jene grosse Einheit der früheren Stile erreichen, dazu einer prinzipiellen Methode bedarf. Ich erwähnte oben, nicht damit bekannt zu sein, ob und inwiefern die ausländischen Architekten schon in ähnlicher Weise gearbeitet haben, aber ich kann Ihnen wohl sagen, dass viele moderne holländische Baukünstler schon längst einigermassen mit dieser Methode vertraut sind. An der Kunstgewerbeschule zu Düsseldorf z. B. werden unter Leitung des holländischen Lehrers Lauweriks alle Entwürfe nach einer ähnlichen, aber sehr speziellen Methode ausgeführt. Er geht allerdings darin am weitesten. Ich hatte noch nicht genügend Gelegenheit, sie zu studieren, um darüber ein Urteil abgeben zu können, kann Ihnen aber ein paar Bilder davon zeigen. Ich führte Ihnen schon ein paar Möbel vor, aber in der Architektur selbst kann ich Ihnen ähnliche Beispiele zeigen.


Es wird sich bei einer Grundrisseinteilung immer praktisch erweisen, vom Quadrat auszugehen und daher den Grundriss in Quadrate einzuteilen.


Geht das immer? werden Sie fragen. Natürlich nicht; d. h. nicht immer in der äussersten Konsequenz; und das war, wie wir gesehen haben, auch früher nicht der Fall. Es ist aber wirklich staunenswert, wenn man es darauf abgesehen hat, wie fast immer eine solche Einteilung gelingt. Es kommt nur darauf an, die richtige Einheit, also das Grundquadrat, zu wählen, wobei selbstverständlich, wenn nötig, auch eine Unterteilung stattfinden kann. Was nun den Aufriss anbelangt, so stellt sich bald heraus, dass eventuell die sogen. Vier-Quadratur nicht zu verwenden ist, indem ein Gebäude dazu zu kompliziert ist. Es stehen aber andere Systeme zur Verfügung, wie übrigens aus den historischen Beispielen schon hervorgeht; z. B entweder die einfache Triangulatur von gleichseitigen Dreiecken, indem man die Höhenverhältnisse nach einem System von gleichseitigen Dreiecken bestimmt, oder indem man z. B. die Höhenverhältnisse nach dem Oktaeder nimmt, d. h. man teile den Aufriss in Dreiecke, die durch die vertikale Projektion des gleichseitigen Dreiecks bestimmt werden; oder auch indem man sonst irgend ein einfaches Verhältnis wählt, dasjenige z. B. des ägyptischen Dreiecks, am grossartigsten verwendet zur Bestimmung der Höhen der Pyramiden, da deren vertikaler Schnitt, wie bekannt, das entsprechende Verhältnis der Höhe zur Basis, 5 : 8, zeigt. Und schliesslich kann auch ein beliebiges Dreieck gewählt werden, wenn es nur einheitlich durchgeführt wird; aber am schönsten wirken nun die einfachen geometrischen und eventuell auch arithmetischen Verhältniszahlen, indem das geübte Auge diese spürt und daher versteht, eine Tatsache, die schon die Griechen, wie ich erörterte, gekannt und daher auch verwendet haben. Uebrigens hat man zu allen Zeiten die gefällige Wirkung der einfachen Zahlverhältnisse zu würdigen gewusst und sogar dazu wieder in der Natur die Vorbilder gefunden, indem es bekannt ist, dass nicht nur die Verhältnisse des menschlichen Körpers, sondern auch diejenigen verschiedener Tiere sich in ganz einfachen Zahlen ausdrücken lassen.

Ich will Ihnen jetzt an einigen Beispielen zeigen, wie dieses Prinzip durchgeführt werden kann. Als letztes Beispiel zeige ich Ihnen das Börsengebäude zu Amsterdam, das gänzlich nach dem ägyptischen Dreieck proportioniert ist. Es besteht also aus einem System von aufgebauten Pyramiden mit dem Verhältnis von 8 : 5 und lässt sich daher mit einer natürlichen Kristallgruppe vergleichen. Der Grundriss wurde dazu in Quadrate von 3,80 m Seitenlänge eingeteilt, welches Mass sich nach langem Suchen als das richtige Grundmass herausstellte. Es ist auch das Achsenmass der Fenster geworden. Ein Blick auf die Zeichnungen wird Sie das alles deutlicher erkennen lassen, als in einer Beschreibung möglich wäre. Als praktische Folge einer solchen Methode zeigt es sich wünschenswert, beim Zeichnen nicht die gebräuchlichen Dreiecke von 60° und 45°, sondern ein mit dem zugehörigen Verhältnis angefertigtes zu benützen, indem sich die richtige Führungslinie alsdann immer ergibt. Bei der Benutzung der 60° und 45° Dreiecke arbeitet man faktisch nicht anders. Zur Herstellung der Zeichnungen für die Börse sind nun Dreiecke mit dem Verhältnisse von 5 : 8 benutzt worden; und da die Führungslinie nun von selbst vor der Hand lag, und die Stileinheit, wie wir gesehen haben, die Durchführung desselben Grundsystems für alle Details wünschenswert macht, kommt man auch von selbst dazu, diese Führungslinie für alle Profile, so wie für die ornamentalen Kompositionen zu gebrauchen. Es sind aus diesem Grunde auch alle Ornamente, ohne Ausnahme, nach diesem egyptischen Dreiecksystem entworfen.



Fast alle Ornamente sind geometrisch; aber es gibt auch einige vegetabilische, wie an den Pfeilern der Warenbörse, die oben mit einem Astragalband umgeben sind, wofür die verschiedenen Handelsprodukte, wie Tabak, Trauben, Reis u. s . w. als Motiv gebraucht sind, und wie gesagt, nach der obengenannten Führungslinie stilisiert. Und dasselbe ist bis zum kleinsten Möbeldetail, geschehen. Ich bin aber noch weiter gegangen. Es gibt in dem Gebäude auch Skulpturen und Wandmalereien, die teilweise nach demselben System entworfen sind. Teilweise; denn man kann bei den heutigen Verhältnissen noch nicht alle Künstler für diese Ansichten gewinnen, indem die meisten sich noch für die "freie Kunst" erklären, und eine bestimmte Linienführung tatsächlich als ein Netz betrachten, in welches sie sich verwickeln würden. Sind denn aber nicht Malerei und Skulptur ebenfalls Verzierung? Und soll diese Verzierung daher nicht ebenfalls stilisiert werden, und zwar nach denselben Gesetzen der sie beherrschenden Architektur? Und das heisst wahrhaftig nicht Geringschätzung, sondern gegenseitige Hochschätzung; während vielmehr die Staffeleimalerei d. h. die freie Kunst, sich der Architektur gegenüber geringschätzend verhält. Und hiermit ist der Punkt berührt, der als eine der prinzipiellen Ursachen der heutigen, künstlerisch ungenügenden Resultate betrachtet werden muss. Man erkennt es als ein Axiom an, dass Skulptur und Malerei die Architektur stützen sollen; aber wie steht es, wenn es auf die Ausführung ankommt? Diese führt verhältnismässig zu guten Resultaten bei Ausführung in sogenannter Stilarchitektur, da in dem Fall der Baumeister immer sehr leicht Künstler finden kann, welche in seinem Geiste arbeiten. Aber bei moderner Architektur geht das nicht so leicht, indem eine feste Uebereinstimmung in Ansicht und Können sich in den meisten Fällen noch nicht erzielen lässt, aus dem einfachen Grunde, weil eine solche Uebereinstimmung nicht existiert. Nur eine Tradition ist imstande, diese Uebereinstimmung zu erreichen, und eine solche ist noch nicht geschaffen. Der moderne Architekt befindet sich daher in der unangenehmen Lage, (abgesehen davon, ob er dazu im Stande is,) entweder selbst auch die Skulptur und Malerei vorzeichnen zu müssen, in welchem Falle er die betreffenden Künstler gewissermassen zu einer Sklavenarbeit zwingt und daher nicht ihre beste Arbeit erhält, oder darauf zu verzichten, wozu die betreffenden Künstler zwar am besten aufgelegt sind, aber dafür kann der Baumeister bei den heutigen Verhältnissen sicher sein, in seiner Architektur kein einheitliches Ganze zu erreichen, indem alle Aussicht vorhanden ist, dass Bildhauer und Maler nicht in seinem Geiste arbeiten. Das liegt nicht an den Künstlern als solchen, sondern an der in Kunstansichten noch ganz unreifen Zeit. Es steht aber fest, dass entweder für die Salonfigur oder für das Staffeleibild innerhalb der entwickelten Stilarchitektur im allgemeinen kein Platz sein wird. Ich sage im allgemeinen, indem die Art und Weise der Umrahmung, die Komposition und das Kolorit dabei immer mitreden, und diese derartig sein können, dass sie sich trotzdem fügen, und zuletzt auch schon wieder ein auf die Spitze getriebenes System peinlich sein kann. Aber, offen gestanden, woher kommt es wieder, dass die meisten modernen Wandmalereien sich in empörender Weise aufdrängen? Weniger noch in Kolorit als gerade in der Komposition? Woher kommt es, dass sie aus der Wand herausfallen? Eben weil sie immer zu viel als Gemälde behandelt sind, d. h. in der ganzen Linien-Zusammenstellung nicht den straffen Linien der Architektur Rechnung tragen und daher immer unruhig wirken. Die Ursache ist allein darin zu suchen, dass den Dekorationsmalern das Staffeleibild noch zu sehr im Blut sitzt, und das ist sehr begreiflich, da auf Akademien nur die eigentliche Gemäldekunst und niemals die für einen gewissen Raum bestimmte Dekorationsmalerei gelehrt wird. Die Dekorationsmaler haben sich von dieser jahrhundertelangen Tradition noch nicht losreissen können, und trotzdem sie ihre Malereien mit Ornament-Umrahmungen versehen, bleiben sie Gemälde und werden keine Wandmalereien so wie früher in architektonischem Geist. Es fehlt ihnen die in den Formen ruhige, in der Farbe harmonische Gestaltung, die nur eine beiderseitige Beschränkung imstande ist zu geben. Und mit den Skulpturen ist ähnliches der Fall. Man weiss ganz gut, was unter architekturaler Skulptur zu verstehen ist, aber trotzdem entdeckt man den Zwiespalt zwischen Architektur und Skulptur, wenn's an die Ausführung geht. Wie die Maler sind auch die Bildhauer noch dermassen von der malerischen Tendenz befangen, dass auch sie sich nicht von ihr loszureissen und durch eine streng gezügelte Linienführung der Architektur anzupassen vermögen. Und wie oft stellt sich nicht der Masstab als ganz verfehlt heraus. Auch dagegen ist eine Schule im obigen Sinne vortrefflich, indem die gegenseitigen Verhältnisse sich wie von selbst ergeben, wobei natürlich das Gefühl wieder das erste, aber auch das letzte Wort zu reden hat. Und wie sieht es schliesslich mit den anderen technischen Künsten aus, mit den mit einer architektonischen Schöpfung so innig verbundenen Gegenständen, Möbeln, Beleuchtungsapparaten und allem sonstigen Gerät? Auch mit diesen Entwürfen hat es einen Haken. In den grossen Stilperioden war es selbstverständlich nicht der Baumeister, der diese Gegenstände zu entwerfen hatte; das war nicht seine Sache, sondern die der betreffenden Gewerbe: Und das war recht! denn man war dessen sicher, dass etwas Schönes und zu der Architektur Passendes entworfen wurde, da das Kunstgewerbe mit dem traditionellen Formenschema aufgewachsen war. Heutzutage sieht es nun damit bös aus, wenn man die wieder ersehnte Einheitlichkeit erreichen will. Die nämliche Ursache wie bei Skulptur und Malerei ist hier im Spiel; denn beim Fehlen eines einheitlich formalen Stils muss der Architekt alles selber tun, wenn er erreichen will, dass äusserlich wie innerlich derselbe Geist sein Werk durchziehe. Ist er dazu nicht in der Lage, dann kann er sicher sein, dass der Möbeltischler, der sein individuelles Stilchen hegt und pflegt, wenn er überhaupt eins hat, Möbel hineinbringt, die der Architektur widersprechen; und dasselbe wiederholt sich ebensoviele Male als wiederum ein anderer technischer Künstler in den Raum hineinkommt. Dabei setze ich sogar noch den günstigen Fall voraus, dass die betreffenden Künstler, jeder in seiner Art und Weise, tüchtig sind. Vorläufig muss daher der Architekt alles selber entwerfen, jedenfalls die betreffenden Künstler nicht selbständig arbeiten lassen. Ich sage vorläufig, indem auch jetzt wiederum danach gestrebt werden muss, dass allen Kunstgewerben die zugehörige Arbeit selbstständig überlassen werden könne. Das kann aber nur dann der Fall sein, wenn einmal eine Einigung im formalen Sinne erreicht sein wird. Der Zweck des ganzen künstlerischen Schaffens unserer Zeit soll nun dahin gerichtet sein, jenes Ziel zu erreichen, jene Einigung zu erzielen, weil sie die Kunst des Raumes, die eigentliche Kunst der Architektur, bedeutet. Erst wenn diese Bedingung in ihrem ganzen Umfange erfüllt sein wird, kann von einer Raumkunst die Rede sein, erst dann wird Harmonie zwischen dem Ganzen und den verschiedenen Teilen, die Einheit in der Vielheit, hergestellt sein. Und eben das hat das 19. Jahrhundert vergessen, von innen nach aussen zu arbeiten. Es hat vergessen, dass die Architektur die Aufgabe hat, Räume zu bilden "qu'une édifice est une nécessité enveloppée." Dagegen hat es alle Kunst auf die Fassade - und was für eine Fassade! - geworfen, und darüber das Innere vergessen. Es hat gerade umgekehrt gearbeitet, von aussen nach innen, aber dafür die Wirklichkeit dem Schein geopfert. Jetzt aber hat die obengenannte Methode in jeglichem Sinne einen grossen Vorzug. Erstens wiederum für den Architekten, wenn er darauf angewiesen ist, das Ganze selber zu schaffen. Im allgemeinen, indem durch das bestimmte geometrische Schema eine Raumeinteilung entsteht, die ein schätzbares Hülfsmittel zur richtigen Plazierung der Möbel und aller sonstigen Geräte bietet, wodurch ihre Stelle gewissermassen von selbst angewiesen und die gewünschte architektonische Straffheit erreicht wird. Im besonderen hat aber diese Methode für den Architekten den Wert, dass er dadurch für die Details der Geräte und die architektonische Ausschmückung der Innenräume ebenfalls die gegenseitige Einheitlichkeit gewissermassen in der Hand hat, jedenfalls sich nicht allzu sehr verirren kann. Und wenn man noch dazu für das Ganze die nämliche Linienführung bestimmt, dann wird man gestehen müssen, wie wertvoll diese ist. Aber zweitens hat diese Methode den Vorzug, den Gewerbekünstlern für den Fall, dass der Architekt das Ganze nicht in die Hand nehmen kann oder will, die Gelegenheit zu geben, im Sinne des Architekten zu arbeiten, d.h. wenn dieser, was das eigentlich Formale der Details anbelangt, selbständig schaffen will, eine grosse Einheitlichkeit durch die betreffende geometrische Grundskala und Linienführung zu ermöglichen. Wenn man schliesslich bedenkt, wie viele technischen Künste hinein bezogen werden können, dann wird man hoffentlich zu der Überzeugung kommen, dass, noch abgesehen von dem Endziel, heutzutage, wenn auch vorläufig noch unter ungünstigen Umständen, in der angestrebten Richtung schon verhältnismässig viel erreicht werden kann.


Ich habe Ihnen die Methode klar zu machen versucht, die m.E. die Grundlage zu einer Vorschule der modernen Architektur im besonderen, zu einer bildenden Kunst im allgemeinen sein könnte. Sie soll auf einer geometrischen Basis beruhen, d.h. die Masse und Formen sollen zu einander in einem einheitlichen Verhältnis stehen, sowohl im grossen Ganzen als auch im Detail. Ich hoffe dazu bei Ihnen die Überzeugung geweckt zu haben, dass eine solche Methode künstlerisch nichts Geringschätzendes oder Unwürdiges bedeute, im Gegenteil nur eine Forderung zu einer höheren Auffassung, weil die künstlerische Phantasie dadurch nicht getötet, sondern gereizt wird. Wenn man den Zweck will, soll man auch die Mittel wollen. Und schliesslich liegt eine solche Methode ganz im Geiste unserer Zeit, der wie von selbst daraufhin arbeitet. Auf allen Gebieten wird einer gewissen Organisation zugestrebt, die am Ende wieder zu einer bestimmten Kultur führen soll, denn Kultur ist sonst nichts als die Übereinstimmung zwischen geistigen und materiellen Bedürfnissen. Jetzt, da wir eine Basis, eine Methode haben, müssen wir zum Aufbau schreiten, d.h. wie soll die zukünftige Architektur sich gestalten?


Die schon erwähnte Tatsache, dass die Architekten des 19. Jahrhunderts, sogar die allerbegabtesten, nicht weiter zu kommen vermochten als zum Eklektizismus, hat ihnen in den letzten zwanzig Jahren von den Modernen viele Vorwürfe eingebracht. Mit Recht? Ja gewiss, aber auch mit Unrecht. Mit Recht, und das wurde in allen Sprachen schon einmal gesagt, weil eine andere Zeit auch eine andere Formengestaltung fordert. Nun kann man allerdings dagegen anführen, dass die Renaissance damals, als sie die antiken Formen übernahm, nichts anderes tat; aber diese Ansicht, obgleich sie vieles für sich hat, ist doch eine zu oberflächliche, denn es war ein ganz neuer Geist, der damals durch die Welt ging, der nur die antiken Formen als Mittel und nicht als Endzweck der künstlerischen Gestaltung betrachtete. Dagegen sind im 19. Jahrhundert unsre Stilbemühungen nicht über den Zweck hinaus gekommen, indem die ungeheure Kenntnis an Stilmaterial, durch Archæologen und Kunstprofessoren gesammelt, doch verwendet werden musste. "Der ästhetisierende Kunstprofessor", sagt Muthesius beissend, "ein neuer Typus des 19. Jahrhunderts, trat sein Amt an und belehrte, begutachtete, kritisierte und systematisierte über Kunst. Er wurde um so mächtiger, je schwächer der lebendige Pulsschlag der Kunst wurde, je mehr das natürliche Kunstleben erstarb. So sitzt an der Quelle der Künste des 19. Jahrhunderts nicht mehr der Künstler, sondern der Kunstprofessor". Dieser Ausspruch charakterisiert erschöpfend die Kunst des 19. Jahrhunderts.


Ich will Ihnen dazu noch einen hierauf bezüglichen Aufsatz eines holländischen Architekten vorführen, der eine Bestätigung der obigen Ansicht gibt, indem darin noch mehr die Entrüstung über die Stil-Architektur ausgesprochen wird. Nach einem kurzen Rückblick sagt er: "Als man bemerkt hatte, dass früher Dinge gemacht wurden, die schöner und konstruktiver waren als die gegenwärtigen, hat man damit angefangen, jene Werke anzuschauen und das äusserlich Schöne daran zu studieren; jedoch ohne zu begreifen, dass es sein Entstehen der Liebe zu verdanken hat, einer Liebe, die jetzt fehlt; deshalb sagte man sich: Wenn ich jetzt etwas mache, was jenem Gegenstand ähnlich sieht, wird es ebenfalls schön sein." Und man hat es jetzt soweit gebracht, dass alle Gegenstände, welche durch die darauf verwandte Liebe schön sind, ohne Liebe nachgemacht werden können; und man steht ganz verwundert, wenn jemand kommt und den Leuten sagt, dass, obgleich das nachgemachte Werk äusserlich dem ursprünglichen ganz ähnlich sieht, trotzdem dieses schön und das andere unbedeutend ist. Denn in der Baukunst ist der Begriff verloren gegangen, dass das Äusserliche eines Werkes die Folge von etwas Innerlichem bei dem Schöpfer sein muss. Oberflächliche Leute nun, die dies nicht wissen, stehen ganz verblüfft, wenn sie das hören. Sie verstehen nicht den Unterschied zwischen echt und unecht, zwischen Wahrheit und Schein von Wahrheit.


Denn weil z. B. in einem griechischen Tempel viel Schönes sein muss, der Liebe zum Bau zufolge, der Liebe, die sich in konstruktiven Gedanken äussert, eben deshalb braucht ein nachgemachter griechischer Tempel noch nicht schön zu sein. Denn wir können noch nicht den konstruktiven Geist besitzen, in dem sich die Liebe der Griechen äusserte; und wenn wir die Liebe haben sollten und dazu einen Begriff von Konstruktion, dann wird sie notwendigerweise ganz anders sein als die ihrige, und mithin muss auch ihre Äusserung sich ebenfalls ganz anders gestalten. Wir können, nach allen unsern Irrungen, wohl wieder auf den guten Weg gebracht werden; das wird aber weder durch Kunstakademien, noch durch Bücher über Schönheitslehre geschehen. Nicht durch Kunstakademien, da sie, was die Baukunst anbelangt, Körperschaften sind, die sich am Schlendrian halten, ganz getrennt sind vom Baufach, fortwährend zwanzig Jahre zurück, immer Theorie lehrend, während die Theorie des Baufaches in einem guten Begriff der Praxis besteht.


Nicht durch Schönheitslehre, denn Philosophie über Kunst wird von einem Künstler gehasst. Wir Künstler, die das Leben lieben und wiedergeben wollen, hassen alle Regeln von Philosophen, durch ihre archaeologischen Studien aus dem Werke unsrer Vorgänger gezogen. Wir wissen, dass Regeln mit Liebe nichts zu schaffen haben, und dass wir der Schönheitslehre entbehren können, ohne Gefahr zu laufen, unser Werk etwas weniger schön zu machen. Es liegt in einem hölzernen Dachstuhl über einer Heuscheune mehr Begriff von Schönheit und in einem Bauernhaus mehr Begriff von Stil, als jemals ein Handbuch über Aesthetik uns lehren kann. Das Wort Aesthetik könnte ganz ruhig aus der Architektenwelt verschwinden; denn, weil wir wissen, das Liebe und Hingebung die Ursprünge schöner Werke sind, begreifen wir ebenfalls, dass Schönheitslehre unsre Liebe nicht vermehren kann. Bücher über Aesthetik sind in einer Zeit erfunden, als die Menschen das Bedürfnis hatten über Kunst zu reden, weil sie keine Kunst mehr machen konnten und diesen Mangel hinwegreden wollten. Niemals ist unter den Händen irgend eines Künstlers, der mit aesthetischen Betrachtungen gesättigt war, etwas Schönes als deren Folge entstanden. Niemals haben Philosophen, indem sie über das Schöne philosophierten, es soweit bringen können, dass sie infolge ihrer Theorien auch etwas Schönes hätten machen können. Und wie komisch ist nicht die Tatsache, dass noch niemals ein Künstler von Bedeutung es gewagt hat, ein Buch über die Lehre des Schönen zu schreiben. Und auch die Kunstgeschichte kann uns wenig helfen. Wer sich nicht mit halber Gelehrsamkeit zufrieden stellt und dadurch nicht zu Torheiten verführen lässt, sondern wirklich nach der Art und Weise sucht, worin sich die besondere Vorliebe eines gewissen Volkes äussert, der wird infolge seiner Studien und Kunstgeschichte lernen, dass Formen Äusserungen jener Vorliebe sind, und, indem er weiss, dass er gerade diese Vorliebe nicht hat, kann er auch jene Formen nicht gebrauchen. Wer nur einen Stil studiert hat, was etwas ganz andres ist als die äusserliche Anschauung der Werke in irgend einem Stil, der weiss, dass kein Künstler sich in den Formen einer andern Vorliebe äussert. Aber die Kunstgeschichte lehrt doch jedenfalls etwas von ganz besonderer Bedeutung: dass Formen sich ändern, sowie die Liebe sich verändert; dass aber das Konstruktive ewig ist und seinen Wert behält. Das, was uns auf den guten Weg bringen kann, ist unser Begriff vom "Künstler sein". Ein Künstler ist ein Mensch, der das Leben seiner Zeit inniger lebt als andre Menschen und dadurch das Leben andrer im voraus lebt; ein Baukünstler ist ein Mensch, der sein ganzes Leben arbeiten muss, den Bedürfnissen seiner Zeitgenossen zu genügen, und danach strebt, seine Werke schön zu gestalten, indem er sein eigenes Leben richtig fühlt, und jenes Fühlen äussert, indem er immer und so viel wie möglich danach trachtet, er selbst zu sein. "Künstler wissen, dass ein jeder, der ans Bauen geht, mit ein wenig Geschmack und ein wenig Anpassungsgeist ganz gut imstande ist, ein Ganzes zusammenzustellen aus Motiven, die den Werken andrer entlehnt sind; ein Ganzes, dass in dem Falle zwar nicht die Eigenschaften der ursprünglichen Werke, aber doch deren Schein besitzt. Künstler kennen den Unterschied zwischen Wahrheit und Schein von Wahrheit, zwischen Schön und Schein von Schön; sie wissen, dass der Scheinbaumeister kein Baumeister, der Stilfabrikant nicht einer der ihrigen ist. Und indem der Begriff der historischen Stile in die Köpfe vieler eingedrungen ist, die es jetzt nicht anders wissen, als dass ein Gebäude, soll es schön genannt werden, in irgend einem Stil gebaut werden muss, so tut es not zu sagen, dass "Bauen in irgend einem Stil nicht die Arbeit eines Künstlers ist, dass Bauen in irgend einem Stil mit Kunst nichts zu schaffen hat." Künstler haben keine Achtung vor einem Scheinmaler, der seine Werke heute im Sinne eines Holbein, morgen wieder im Sinne eines Velasquez und übermorgen wieder im Sinne eines Watteau machen würde; Künstler haben keine Achtung vor einem Bildhauer, der von der Nachahmung irgend eines berühmten Griechen, eines Michel-Angelo oder eines Peter Vischer lebt; Künstler haben keine Achtung vor einem Architekten, der aus irgend welcher Ursache seine Schöpfungen in irgend einem nachgeahmten Kleid gestaltet und damit sich selbst und seine Zeit verleugnet. Jemand, der seine Zeit nicht begreift und demzufolge nichts als Äusserlichkeiten zu er zählen hat, nur so einer kann, um Geld zu verdienen, Gebäude in Stilarchitektur entwerfen; denn Stilarchitektur ist nicht ein Kunstgegenstand, sondern ein Gegenstand des Handels, aus dem Laden eines Architekt-Kaufmannes. Stilarchitektur ist nicht die Arbeit von einem, der sich durch sein eigenes, von ihm selber geprüftes Gemüt äussern will. Stilarchitektur steht, als etwas von einzelnen Angelerntes, ausserhalb des Volkes, ist etwas Unnatürliches bei einem Künstler. Stilarchitektur ist der Kunstgriff eines Pseudo-Architekten, ist die Devise eines Kaufmannes in baukünstlerischen Entwürfen, der seine Ware anpreist. Stilarchitektur ist etwas ausserhalb der Kunst Stehendes, und hat nur den Schein mit der Baukunst gemeinsam. Stilarchitektur ist die Lüge eines Mannes, der für einen Künstler gehalten werden will, ist das Treiben eines Handelsmannes, der Architekt scheinen möchte. Stilarchitektur endlich ist der Handgriff eines Mannes, der Liebe lügt, und Lügner und Künstler sind zwei verschiedene Menschen. Stilarchitektur und Künstler sein geht nicht zusammen." Dieser Artikel ist vom Jahre 1894, und obgleich der Verfasser selber wahrscheinlich jetzt nicht mehr alles unterschreiben möchte, so bleibt doch die Hauptsache, die Ansicht über Stilarchitektur, unangefochten bestehen. Gegen diese Ansicht sind jedoch nicht nur Milderungsgründe anzuführen, sondern sogar Verteidigungsgründe für sie. Man könnte sie kurz in der Erwägung zusammenfassen, dass die Zeit zu einer Umwälzung noch nicht gekommen war. Welche philosophischen Betrachtungen man auch dazu anführen möge; entweder solche fatalistischer Natur mit dem Resultat, dass alles doch so kommen musste, indem kein Mensch, und sei er noch so stark, sich gegen den Zeitgeist zu widersetzen vermag; oder solche mehr ideeller Natur, mit dem endgültigen Empfinden, dass man sich in dem früheren Stile nur allzugut zu Hause fühlte und die altvaterländische Renaissancekunst schliesslich doch das trauteste Heim bot, die prinzipielle Ursache der Verwendung von Stilarchitektur kann doch auf jenen Geist der Zeit geschoben werden, auf ihre Unreifheit für Kunstanschauungen, die in die Zukunft blickten. Hat denn unsere jetzige Zeit die Reife dazu? Auf diese Frage, in solcher Kürze gestellt, gehört sich eine vorsichtige Antwort; man kann sie zwar mit "Ja" beantworten; nur soll diese Antwort insofern mit einiger Zurückhaltung gegeben werden, als man nicht erwarten soll, dass die Hoffnung auf eine neue Kunst, d.h. auf einen neuen Stil, schon in einigen Jahren in Erfüllung gehen werde. Doch hat das 19. Jahrhundert, das sich in der Architektur am deutlichsten als das des chaotischen Durcheinanders aller Stile der Vergangenheit kennzeichnet, wenigstens dieses Resultat gehabt: "eine völlige Entwertung dieses Stiltreibens, und eine so weitgehende Ueberzeugung von dessen Verkehrtheit, dass die blosse schulmässige Anwendung eines geschichtlichen Architekturstils nicht mehr als Verdienst gilt, ja kaum mehr unser Interesse in Anspruch nimmt. Es steht heute ausser aller Frage, dass keiner der wieder aufgenommenen alten Architekturstile als Gegenwartstil sich bewährt, dass sich keiner von ihnen als lebenskräftig erwiesen hat.'' Soweit wieder Muthesius. Also, allen Anstrengungen zum Trotz, hat das 19. Jahrhundert nur das tragische Los, es erstens soweit gebracht zu haben, dass durch die Ausbeutung aller Stile das Interesse für diese gänzlich verloren gegangen ist, und zweitens bewiesen zu haben, dass keiner der alten Architekturstile uns für unsre heutigen Bedürfnisse genügen kann. Das ist allerdings ein negatives Verdienst. Gibt es denn kein positives? Ich glaube doch. Denn es gibt keine Zeit, und sei sie noch so verwirrend, die nicht einige Ergebnisse von positivem Wert aufweisen könnte. Und daher können unter den vielen Kunstergebnissen des 19. Jahrhunderts doch wohl einige ausgenommen werden, die sich für die Zukunft als sehr wertvoll erweisen dürften, - nämlich die beiden Haupttendenzen, die Neorenaissance und die neogotische Richtung. Jedoch bleibt nicht zu leugnen, dass es prinzipiell der mittelalterlichen Kunst vorbehalten blieb, uns den neuen Weg zu ebnen. Ich hatte schon früher Gelegenheit diese Ansicht näher zu erörtern, und zwar in einem Vortrag "Gedanken über Stil," so wie in ein paar Vorträgen, die ich das Vergnügen hatte vergangenen Winter in Zürich zu halten: "Einige kritische Betrachtungen über alte Bau- und Kleinkunst." In dem ersten Vortrag heisst es: Ich habe die beiden grossen, praktischen Aesthetiker, Semper und Viollet-le-Duc genannt, und glaube nun das Verdienst Viollet-le-Ducs in dieser Beziehung jedenfalls nicht niedriger stellen zu müssen als das Sempers; denn er hatte eingesehen, dass die mittelalterliche Kunst prinzipiell für die moderne Zeit die richtige Grundlage angeben konnte; sie steht nämlich nicht nur auf konstruktivem Boden, sondern sie bildet gewissermassen den Faden zwischen Alt und Neu, und wir müssen diesen Faden an der richtigen Stelle wieder aufnehmen. Daher war die klassische Kunst, d. h. die italienische Renaissance oder die ganze Neo-Renaissancebewegung um die Mitte des vorigen .Jahrhunderts nur von vorübergehendem Wert. Die Neubelebung einer Kunst, die selber schon nicht prinzipiell konstruktiv war und daher sehr bald in eine rein dekorative Richtung verfiel, war von vornherein bedenklich; denn da mussten ihre Apostel wohl bald auf Widersprüche stossen. Diese blieben denn auch nicht aus. Sogar Semper, von dem man erwarten sollte, dass er das Prinzip der mittelalterlichen Kunst besser verstanden hätte, ist von diesen Widersprüchen nicht frei geblieben. Und die Tatsache, dass die Renaissance nicht prinzipiell konstruktiv war, und daher sehr bald in eine dekorative Richtung sich verirrte, habe ich in dem Züricher Vortrag zu entwickeln versucht; indem ich die bedenkliche Verwendung des Säulen- und Pilasterschemas durch die Römer hervorhob, nämlich eine Verwendung nicht als freistehende Pfeiler und Säulen, sondern als ein gegen die Wand geklebtes Dekorationsmittel, mit allen den bedenklichen Folgen von Kapitälzerschneidung, verkröpften Gebälkstücken, angeklebten Wasserrinnen u. s. w., wobei man nicht einmal so weit zu gehen braucht wie Hegel, der sogar Halbsäulen schlechthin widerlich nennt, weil dadurch zweierlei entgegengesetzte Zwecke ohne innere Notwendigkeit neben einander stehen und sich mit einander vermischen. Und ich kann mich in dieser Beziehung wieder auf eine Autorität wie Muthesius berufen, der in seiner Schrift über die "erste Kunstrevolution," d. h. die Renaissance, sagt: "Es kam die Zeit, dass die antike Welt, deren Geist auch nach ihrem körperlichen Untergange in mächtiger Grösse fortlebte, neue künstlerische Ideale über den Norden brachte. Die Zeit des Humanismus in den Geisteswissenschaften, der Renaissance in den Künsten, trat ihre Herrschaft an und führte eine Blütezeit der Künste herauf, die sich bezeichnender Weise besonders in der Malerei und Skulptur zeigte. In der Architektur war sie durchaus nicht in gleichem Masse vorhanden. Konnten damals in der Malerei und in gewissem Sinne auch in der Bildhauerkunst die neuen Einflüsse auf Vorhandenes einwirken, ein vorliegendes Frühalter zur Reife bringen, so wurde in der Architektur mit einer vollentwickelten Kunst barsch gebrochen, eine reichentfaltete Kunstüberlieferung in die Ecke geworfen. Was man dafür als Renaissancebaukunst erreichte, konnte doch nur ein blasses Abbild einer besseren Originalkunst sein, worüber jeder Italienreisende klar sein wird, wenn er bemerkt, wie ein einziges antikes Bauwerk - etwa das Colosseum oder das Pantheon in Rom - die ganze Renaissancebaukunst in den Schatten stellt. Wenn also die Renaissancearchitektur schon nicht mehr als ein blasses Abbild des ursprünglichen Stils hervorbrachte, wie soll es denn mit der Neo-Renaissance aussehen? Denkt man dabei nicht unwillkürlich an einen Grog, zu welchem irrtümlicherweise noch einmal Wasser geschüttet wurde." Eine zweite Autorität, auf die ich mich in dieser Angelegenheit berufen kann, ist Karl Scheffler, der die Kunstentwicklung mehr vom philosophischen Standpunkt betrachtet, und in seiner Schrift über die »Konventionen der Kunst" die Neo-Renaissancebewegung sogar einen Verzweiflungsakt nennt, eine geniale Impotenz, eine Episode. Ich habe neben Viollet-le-Duc Semper genannt, als den zweiten genialen Architekten und Kunstgelehrten, der seine Ansichten über Kunst in seinem unsterblichen Werke: "Der Stil in den technischen Künsten" niedergelegt hat. Was der erste in seinem »Dictionnaire Raisonné" und seinen "Entretiens sur l'architecture", vielleicht das Schönste, was jemals über Architektur geschrieben, ausführt, das hat der letztere in seinem "Stil" entwickelt. Viollet-le-Duc geht von der mittelalterlichen Kunst aus, die für ihn den Inbegriff des prinzipiell reinsten baukünstlerischen Stils vergegenwärtigt, und entwickelt aus ihm die für ihn als allein richtig befundenen Stilbegriffe. Semper dagegen ist mehr Philosoph, entwickelt seine Ideen über Stil, zieht aber daraus keine "bestimmte Folgerung" und verfällt demzufolge in gewisse Irrtümer, welche vielleicht teilweise durch seine Erziehung erklärt werden können, die schon von vornherein eine gewisse Sympathie für das klassische Altertum bei ihm erweckte. Das ist selbstverständlich an und für sich kein Fehler; aber doch sollte diese, ich wage es gerade heraus zu sagen, sich für die Baukunst des 19. Jahrhunderts als schädlich erweisen. Diese Ansicht bedeutet aber wahrhaftig keine Geringschätzung jenes Meisters, denn er bleibt der hochbegabte Führer; aber leider ist er einer von all den »Opfern des Genies", wie Scheffler sagt, »die keine Resonanz in ihrer Zeit fanden, und dann auf alte Konventionen zurückgriffen, konventionell wurden". Er, Semper, ist der grösste General »auf den Schlachtfeldern der Kunst, welcher innerhalb einer gefesteten Epoche Unsterbliches geleistet hätte, welcher dem Masse der Energieentwickelung nach hinter keinem Meister der Vergangenheit zurück steht, aber dessen Wirken doch nur Episode bleiben kann". Und hier berührt sich seine wirklich an und für sich ebenfalls unsterbliche Arbeit mit dem Fatalismus aller Menschenarbeit im allgemeinen, indem auch er nach Goethescher Ansicht »mit einer Schwachheit an seiner Zeit zusammen hängt". Denn wie gesagt, es ist unbegreiflich, dass Semper, der Autor des Buches "Der Stil in den technischen Künsten", das bezweckt, die Ursprünge der Kunst und ihre Entwickelung aus natürlichen Ursachen zu erklären, alles Ueberflüssige und allen falschen Schein, ja jede der Natur der Gegenstände widerstrebende Äusserung zu verdammen, und darin wirklich apostolisch auftritt, und mit ungemein scharfem Verstand den Kunsthumbug des 19. Jahrhunderts geisselt, dass derselbe zu einer architekturalen Inkonsequenz kommen konnte. Denn er hat nicht wie Viollet-le-Duc Griechenland von Rom zu unterscheiden gewusst und kam mit der fatalen Sympathie für das Italien der Hochrenaissance zu der Ueberzeugung, der modernen Baukunst eine feste Leitung geben zu können. Ich glaube aber, dass wir wohl jetzt soweit gekommen sind, an dieser Leitung zu zweifeln, indess wir bemerken, dass diese Periode nur eine vorübergehende sein konnte. Und so kam ich dazu, den Ausdruck zu gebrauchen "Zum Schaden für die Baukunst". Hätte Semper, der in seinem "Stil" Dinge von unsterblichem Wert gesagt hat, nur die Folgerichtigkeit in die Architektur gezogen! Wie anders hätte dann unter seinem Einfluss die Architektur in Deutschland und hier ausgesehen. Denn wie grossartig in der Auffassung einerseits, und wie fein in den Details andrerseits, war nicht die Kunst dieses Meisters! Und das Allerwichtigste wäre gewesen, dass seine Kunst sich viel lebensfähiger gezeigt haben würde, denn mit einer solchen Auffassung würde sie die Keime für eine Entwicklung in der Zukunft in sich gehabt haben. Wirklich tragisch ist es aber, jetzt erkennen zu müssen, dass sie nur von vorübergehendem Werte gewesen ist. Wäre aber schliesslich eine solche Vollkommenheit in der damaligen Zeit nicht zu viel verlangt gewesen? Fassen wir nun diese Betrachtungen zusammen, dann kommt man zu der Schlussfolgerung, dass von allen Versuchen des 19. Jahrhunderts die beiden Hauptrichtungen, die Neo-Renaissance und die Neo-Gotik wertvoll gewesen sind, dass aber von diesen beiden nur die Neo-Gotik die befruchtende gewesen, indem diese wieder den Blick nach der mittelalterlichen Kunst gelenkt hat, die die Keime für die Zukunft in sich birgt. Weshalb sollten wir nun bei der mittelalterlichen Kunst in die Lehre gehen? Um für die Zukunft etwas schaffen zu können? Und sollten wir überhaupt bei früheren Stilen in die Lehre gehen, während doch schon eingehend erläutert wurde, dass Stilarchitektur eine Liebeslüge wäre, und obendrein die Neo-Renaissance sich als eine Stilinkonsequenz herausstellte? Es scheint nach dem unmittelbar Vorhergegangenen, dass diese Frage mit einem absoluten Nein! beantwortet werden muss. Jetzt auch nichts mehr von dem Vorhergegangenen, keine von all den abgeschwächten Formen mehr. Das 19. Jahrhundert hat uns die Liebe zur Stilarchitektur absolut vergällt; wir leben in einer anderen Zeit, die daher eine besondere Kunst verlangt! Allerdings kann die richtige Antwort auf diese Frage nur unter einer gewissen Zurückhaltung gegeben werden, als es schliesslich lediglich auf das "Wie" ankommt. Man kann ganz gut in die Lehre gehen, wenn man sich nur gut vorstellt, wie man in die Lehre gehen soll. Und schliesslich muss man wohl in die Lehre gehen, wenn man nicht anders kann! Was ist der Fall? In meinem schon obengenannten Vortrag "Gedanken über Stil'' zitierte ich einige Sätze aus Sempers Stil. Sie werden erlauben, dass ich sie an dieser Stelle wiederhole. "Ja, die Natur, die grosse Urbildnerin, muss ihren eigenen Gesetzen gehorchen, denn sie kann nicht anders als sich selbst wiedergeben; ihre Urtypen bleiben dieselben, durch alles, was ihr Schoss in den Äonen hervorbrachte." Diese Hegelsche Ansicht, welche Semper zu der seinigen machte, spricht auch in Bezug auf die Kunst ganze Bücher. Sie sagt nicht mehr und nicht weniger als folgendes: Bedenkt, ihr Künstler, wie die Natur ihre Urtypen umformt, so könnt ihr selbst auch nur die ursprünglichen Kunstformen umformen; neue machen könnt ihr nicht, und versucht ihr das, dann werdet ihr unnatürlich, d.h. unwahr. Denn, weshalb sollte der Mensch mehr können als die Natur, indem er doch selber der Natur gehorchen muss. Und in der Tat! Lehrt nicht die ganze Geschichte der menschlichen Kultur, dass diese sich immer wiederholt, dass nur das Formale sich ändert, aber die gegenseitigen Verhältnisse dieselben bleiben; dass, kurz gefasst, die Grundlage der Kultur dieselbe bleibt? Diese Tatsache gibt nun, was die Kunst betrifft, auch sofort die Antwort auf die obengestellte Frage, nämlich "Wie man in die Lehre gehen soll?" Sie lautet: Nicht was das Formale anbelangt, sondern nur, was die ewig dauernde Grundlage betrifft! Also, forscht daher nicht dem Wesen, sondern dem Geist nach! Zieht man nun, was die Stilauffassung betrifft, die richtige Folgerung, dann bleibt dem Künstler nur folgendes zu sagen: Bilde deine künstlerischen Formen um, d. h. kopiere sie nicht; denn das Kopieren ist verwerflich, weil du dann nur an dem Äusserlichen hängen bleibst, und es in solchem Fall nicht weiter bringen kannst, als nur ein blasses Abbild vom Original zu geben! Die kopierten Formen sind nicht die deinigen, sind nicht von deiner Liebe! Aber tue wie die Natur, - forsche nach dem Geist, der den grossen Werken früherer Zeiten innewohnt und ewig derselbe bleibt, aber bilde das Formale um, d. h. wähle andere künstlerische Formen, denn diese werden von deiner Liebe gezeugt sein! Die Stilarchitektur des 19. Jahrhunderts nun hat sonst nichts vermocht, als das bloss Formale der früheren Stile zu dem ihrigen zu machen. Sie hat gemeint; indem sie das Formale gründlich studierte, auch ihres Geistes teilhaftig zu werden, hat sich aber nur in die blosse Stilauffassung verwickelt. Und deshalb verblasste sogar früher schon die italienische Renaissance der klassischen Kunst gegenüber, insofern sie, wenigstens was die Baukunst betrifft, nur das Formale übernahm; und deshalb war schon die römische Kunst in gewissem Sinne bedenklich, weil in ihr sich nur das Formale der Griechen und nicht deren Geist wiederspiegelte. Und dieser Geist ist das ewig wahre, reine, konstruktive Baugesetz. Dieser Geist ist daher nicht der originelle Teil einer Kunst, denn die Originalität hängt vom Formalen ab. Hat man den Geist gefasst, dann hat man noch nichts Originelles getan, sondern nur ein ewiges Gesetz verstanden. Und hat man das Formale nur kopiert, dann hat man nichts Besonderes getan. Hat man aber das Formale umgeformt, dann hat man etwas Originelles zustande gebracht so wie die Natur, und zwar mit einfachsten Mitteln, dasselbe tut und daher immer originell ist. Daher sind für das Abendland nur zwei Stile originell zu nennen, der griechische und der mittelalterliche, und sind es eben auch nur deshalb diese zwei gewesen, die imstande waren, über alle übrigen Kulturperioden weit hinaus zu gehen. "Von historischen Zeiten", sagt Muthesius, "ragen in unserer westlichen Kultur zwei Glanzperioden der Menschheit als vorwiegend künstlerisch heraus; das griechische Altertum und das nordische Mittelalter, das erste eine Höhenmarke in künstlerischer Beziehung andeutend, die die Welt wohl kaum je wieder zu erreichen hoffen kann, das zweite wenigstens jene vollkommene künstlerische Selbständigkeit und jene unbedingte Volkstümlichkeit der Kunst verkörpernd, die man als Grundbedingungen einer künstlerischen Zeit voraussetzen muss. Die griechische Kunst war so mächtig, so triumphierend, so überlegen, dass nicht nur die gesamte Kultur ihres Heimatlandes unter ihrem Einfluss stand, sondern dass auch das ganze gewaltige römische Reich - künstlerisch selbst unfruchtbar - lediglich von ihr lebte. Die gotische Kunst, keineswegs ohne allen Zusammenhang mit jener, aber doch eine vollkommen selbständige Kulturerscheinung, ist die einzige Originalkunst, die in der abendländischen Welt neben der griechischen Kunst entwickelt worden ist. Hing von der griechischen Kunst das ganze Altertum ab, so ruhen in der Gotik die Wurzeln der Kunst einer neuen Zeit, der Kunst der nordischen Völker, aus denen sich in jener ersten gotischen Blütezeit eine so herrliche Frühernte der Architektur und der von ihr abhängigen Künste entwickelte. Das gotische Mittelalter bildet den ersten Triumph einer von der klassischen grundverschiedenen Kunst, hoch entwickelt, durchaus einheitlich in allen ihren Erscheinungen, alle Leistungen der menschlichen Hand durchdringend, und vor allem, in bestem Sinne, volkstümlich. Es ist daher in seiner Art eine durchaus vollkommene Kunstzeit." Ziehen wir nun hier wieder die Folgerung, bei Erwähnung der Tatsache, dass es gerade diese beiden grossen Architekturen sind, welche nach einem gewissen geometrischen Gesetz sich entwickelt haben, dann fragt es sich, ob wir, indem wir den Geist fassen wollen, nicht ebenfalls wieder mit einem geometrischen Gesetz anfangen sollen? Ich glaube diese Frage in bejahendem Sinne beantworten zu müssen und dabei diesen zweiten Punkt feststellen zu dürfen, sowie den schon erwähnten, dass man keine Formen von früheren Stilen kopieren soll. Es bleibt aber jetzt noch ein dritter Punkt übrig, indem das geometrische Gesetz nur Mittel ist und daher nur einen untergeordneten Teil des eigentlichen Geistes des Stils ausmacht, den Hauptteil dieses Geistes hervor zu heben, zu studieren, zu untersuchen. Es ist, bei allen Betrachtungen über die Architektur in den letzten Jahren, viel und immer wieder über "das Konstruktive" geredet worden, und ich selber habe es jetzt in diesen Vorträgen auch wieder genannt. Aber dieses Wort kann sehr leicht zu Misverständnissen Veranlassung geben. Wenn ich zu einem, der es nun einmal darauf abgesehen hat, mich nicht verstehen zu wollen, behaupte, dass ein eiserner Pfeiler, der mit Stuck bekleidet ist und nachher eine Säulenform im Geist der Antike bekommt, nicht konstruktiv sei, wird er mich fragen: "Weshalb nicht? Das Ding hält; ich kann ihm ja doch diejenige Form geben, welche ich will, also ist es konstruktiv". Wenn ich eine Halle betrete, etwa mit einer Säulenarchitektur, die überwölbt d. h. deren Gewölbe aus Gipsmasse hergestellt ist, über dem sich selbstverständlich ein leerer Raum befindet, der vom Fussboden der oberen Etage abgeschlossen wird, und ich würde zu ihrem Konstrukteur sagen, dass diese Halle nicht konstruktiv sei, würde er wahrscheinlich sehr bös werden, mich wiederum fragen: "Weshalb nicht?" und hinzufügen, dass diese Konstruktion während Jahrhunderten so gemacht wurde, und ob ich es denn besser machen wolle als ein Sangallo oder ein Perruzzi. Und wenn ich schliesslich den Baumeister einer Fassade, mit einem Turm gekrönt, fragen würde, weshalb ich im Grundriss zur Stütze dieses Turmes nur ein paar Pfeiler vorfinde, welche durch einen eisernen Träger die Last des Turmes aufnehmen; dann würde dieser Baumeister mich wahrscheinlich für verrückt halten und sogar aus dem Grundriss gotischer Dome herleiten, dass daselbst die vierte Ecke der Türme ebenfalls auf einem Pfeiler ruhe. Ich muss gestehen, dass ich in einem solchen Falle mit einer schlagenden Antwort nicht sofort fertig bin; trotzdem ich weiss, wie pedantisch das auch klingen möge, dass ich recht habe. Ich sage, mit einer schlagenden Antwort nicht sofort fertig zu sein, indem man bedenken muss, wie viele neue Konstruktionen heutzutage auftauchen, Erfindungen der Industrie, die darauf hinzielen, immer praktischer bauen zu können; Erfindungen, die aber eine solche Umwälzung in der ganzen Bautechnik hervorrufen, dass eine Erläuterung, was man unter einer sogenannten konstruktiven Bauweise, auf Grund der Materialbenutzung, zu verstehen habe, nicht so ganz leicht ist. Ist doch z. B. die Erfindung des armierten Betons eine derartige, und deshalb eine solche Erläuterung nicht ohne Schwierigkeit. Ich glaube nun, dass es sich beim eventuellen Misverständnis nur um eine Wortfrage handelt und z. B. das Wort sachlich besser gewählt wäre, welches ohnehin den Vorzug hat, auch vom Laien besser verstanden zu werden. Nun hat das Wort einen Nachteil, sich unkünstlerisch anzuhören. Dieser Nachteil lässt sich jedoch überwinden, wenn man sich nur vornimmt, das Wort "sachlich" nicht mit "geschäftlich" zu verwechseln. Und alsdann frage man sich, ob eine Kunst, die sachlich ist, keine Kunst sei. Ob es unkünstlerisch ist, immer peinlicher zu erwägen, welche Zusammenstellung am einfachsten ist, welche am logischsten sich entwickelt; und dann sei damit natürlich nicht die räumliche Einteilung des Gebäudes gemeint, indem ein Streben in diesem Sinne als etwas Selbstverständliches vorausgesetzt werden muss, sondern die künstlerische Form. Denn es gibt nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine künstlerische Sachlichkeit. Ist es denn unkünstlerisch, bei der Formgebung nicht zuerst an die Verzierung, an das Ornament, sondern zuerst an eine Linienführung zu denken, die sich so einfach wie möglich aus der primären Form entwickelt? Ist es denn unkünstlerisch, auch in der Formgebung alles Überflüssige weg zu lassen, d.h. alles dasjenige, was nicht direkt zu der architektonischen Konstruktionsnotwendigkeit gehört, und den Masstab der Folgerichtigkeit daran zu legen, wodurch der Satz Viollet-le-Ducs: "que toute forme, qui n'est pas ordonnée par la structure, doit être repoussée," seine richtige Anwendung findet ? So wie sich denn immer in der "Beschränkung der Meister zeigt", so geht's auch hier, ein Satz, der nebenbei den Beweis zur allgemein bekannten Tatsache liefert, dass nicht die kompliziertere, sondern die einfachere Form immer die grössten Schwierigkeiten macht. Und Ihr seid Künstler genug, um zu begreifen, dass das Gefühl dabei die Grenze zwischen Nüchternheit und Einfachheit zu ziehen hat; d.h. die Unterscheidung zwischen Nicht-Künstler und Künstler, indem die Arbeit des wahren Künstlers, so einfach sie auch sein möge, niemals nüchtern sich gestaltet. Also eine sachliche, d.h. eine konstruktive Kunst, sei die Parole, und im Falle des Zweifels bei diesem Ausspruch werden Sie es mir nach den vorhergegangenen Betrachtungen nicht verdenken, wenn ich behaupte, dass die beiden grossen Stile, der griechische und der mittelalterliche, ebenfalls "sachlich" gewesen sind, indem gerade diese beiden den oben gestellten Forderungen von einfacher verständlicher Formgebung entsprachen. Und waren diese beiden Stile die am wenigsten künstlerischen? Im Gegenteil. Denn ist nicht das dorische Kapitäl, entwickelt aus dem architektonischen Formenbedürfnis, das denkbar einfachste und eben deswegen nicht das denkbar schönste? Und ist nicht der dorische Metopenfries, ebenfalls aus der architektonischen Grundform entwickelt, eine Verzierung, die niemals langweilt, von ewiger Schönheit und doch von einer verblüffenden Einfachheit. Und ist nicht ferner ein romanisches Portal, einfacher kaum zu denken, mit der feinsten künstlerischen Empfindung aus der Mauer ausgeschnitten, aber deswegen von einer Schönheit, die sich kaum edler denken lässt; und wird diese Regel nicht durch die Beobachtung bestätigt, dass in allen Fällen, wenn diese Formen sich allmählich zu einer reicheren Entfaltung entwickeln, auch eine Schönheitseinbusze bemerkbar wird, wenn die Klarheit getrübt wird, trotzdem diese bei der reichsten Entfaltung vorhanden sein kann? Und so wird jetzt klar, warum es gerade der Renaissance von vornherein bestimmt war, architektonisch nicht zu befriedigen, weil sie das ursprünglich klare Säulen-und Pfeiler-Schema als Dekorationsform, also in unklarer Weise, nicht als eine aus dem architektonischen Bedürfnis hervorgegangene Notwendigkeit verwendete. "Nur hütet euch", ruft schon Goethe aus, "die Säule ungehörig zu gebrauchen; ihre Natur ist frei zu stehen. Wehe den Elenden, die ihren schlanken Wuchs an plumpe Mauern geschmiedet haben!" Und wie bekannt, waren es schon die Römer, die in dieser Verwendung vorangingen. Wie gesagt, die Meister der Renaissance haben nur das nicht originell formale Formenschema übernommen, welches sie zwar mit einer wirklich originellen Verzierung, einem sprudelnden Renaissanceornament, zu beleben, aber nicht zu retten wussten. Daher ist auch ein ornamentloses Renaissance-Gebäude das allerdürrste. Aus alledem geht hervor, dass wir bei den beiden grossen Stilen, dem griechischen und dem mittelalterlichen, in die Lehre gehen müssen, namentlich aber bei dem letztern, da in diesem die Wurzeln der Kunst einer neuen Zeit ruhen. Und das ist der Fall, weil diese ebenfalls sachlich ist. -
"Denn," sagt Muthesius am Ende seiner Schrift "Stilarchitektur und Baukunst", "auf eine sachliche Kunst hatten im Grunde schon die unklaren romantischen Bestrebungen, soweit sie in der Architektur sich äusserten, abgezielt; sie waren, als höchst bezeichnendes Merkmal, im 19. Jahrhundert zum ersten Male wieder auf jene Anschauung einer im Keim ihres Wesens sachlich und wirklich empfindenden Kunst zurückgekommen, die die gotische Zeit, ich stipuliere, in so grosser Klarheit verkörpert. Nur der Umstand, dass sich die neugotische Schule in derselben Weise in das äusserlich Formale, ich stipuliere wieder, in die blosse Stilauffassung verwickelte, wie es die klassizistische getan hatte, konnte den grossen Umbildungsprozess etwas verdunkeln, der sich, trotz aller Schwankungen und Gärungen im 19. Jahrhundert mit steigender Folgerichtigkeit zu vollziehen begann; der Ersatz des klassischen Schönheitsideals durch ein neues, dem nordisch germanischen Geiste entsprechendes." Ich sagte, dass wir den Geist der beiden früheren Stile studieren sollten; jetzt sehen wir, dass dieser Geist in "Sachlichkeit" besteht, die sich als identisch mit "klarer Konstruktion" heraus stellt. Abgesehen nun noch von der allgemeinen Richtigkeit der ewig gültigen "Baugesetze" ist es von Interesse zu bemerken, wie gerade diese Zeit, sogar in leidenschaftlicher Weise, nach Sachlichkeit drängt. Ich hatte in meinen vorigen Vorträgen in Zürich schon Gelegenheit, diese Tatsache hervorzuheben, wie z. B. deutlich zu erkennen ist, dass "die Zeitentwickelung auf Ablegung des Schmucks hindrängt" und zwar mit entschiedener Hervorhebung des rein Zweckmässigen, zu welcher Bestätigung ebenfalls eine interessante Schrift von Muthesius genügende Aufklärung gibt, die "Umbildung unserer Anschauungen." Es mag nun einerseits allerdings richtig sein, dass diese Tendenz durch die grenzenlos übertriebene, absolut unmotivierte Verzierungswut des 19. Jahrhunderts als Reaktion hervorgerufen wurde; nicht zu leugnen bleibt, dass schon seit 10 Jahren ein Anfang mit der Bildung von schmucklosen Gegenständen gemacht wurde; dass ihre Erscheinung anfangs selbstverständlich eine scharfe Kritik zur Folge hatte; dass man aber heutzutage doch schon so weit gekommen ist, sie zu genehmigen. Und dazu gesellt sich schon, wenn man will, eine schmucklose Architektur, d. h. eine sparsam geschmückte, denn im Vergleich zur früheren findet man diese jetzt schmucklos. Ich zog aus diesen Erscheinungen jedoch nicht die äusserste Konsequenz, nämlich die Behauptung, dass wir einer schmucklosen Kultur zustreben. Im Gegenteil. Die Erscheinungen geben zu erkennen, dass gerade heutzutage ein ganzes Heer von Ornamentisten sich mit dem modernen Ornament beschäftigt, und daher scheint es mir, dass die zukünftige Kunst nicht schmucklos sein wird, weil schliesslich der innerliche Drang des Menschen gerade zum Schmuck zuletzt doch siegen wird. Was nun aber ebenfalls in der Verzierung, im Ornament, in Uebereinstimmung mit der grossen Eigenschaft im allgemeinen, als führender Geist wirksam sein sollte, das ist wiederum die Sachlichkeit; d. h. das Ornament soll sich ebenfalls durch Klarheit in der Linienführung, durch Einfachkeit in der Bildung auszeichnen. Aus diesen Betrachtungen können wir daher folgenden Schluss ziehen, der den Weg bestimmt, welchen wir jetzt einschlagen müssen, den Weg, welcher für die Zukunft wertvoll sein kann, und welcher uns zu einer neuen Kunst führen soll. Erstens: Die Grundlage einer architektonischen Komposition soll wiederum nach einem geometrischen Schema bestimmt werden. Zweitens: Die charakteristischen Formen früherer Stile sollen nicht verwendet werden. Drittens: Die architektonischen Formen sollen nach der sachlichen Seite hin sich entwickeln. Was den ersten Punkt anbelangt, habe ich im Anfang darzulegen versucht, dass die beiden grossen Stile sich ebenfalls auf einer geometrischen Basis aufgebaut und eben deshalb ihre hohe künstlerische Gestaltung erreicht haben. Und wenn auch nicht für alle Fälle eine geometrische Formbildung nachzuweisen war, so sollte uns das doch nicht hindern, eine solche gänzlich durchzuführen. Denn es ist keine Gefahr vorhanden, dass man durch deren Benutzung zu dogmatisch werde. Im Gegenteil; denn ein Nicht-Künstler bringt es mit diesem System ja doch zu nichts, und in den Händen eines Künstlers ist es eine Triebkraft, indem er die geometrische Form zu beherrschen versteht, sie Mittel bleiben lässt, und an richtiger Stelle dieselbe zu verlassen weiss. Der wahre Künstler sorgt schon dafür, dass mit dem Prinzip die Welt nicht zu Grunde geht. Uebrigens gibt es bei den Alten Abweichungen, die einerseits nicht anders als gerade aus der richtigen Konsequenz des Systems zu erklären sind und daher den Beweis liefern, dass das System selbst schon vor dürren Resultaten bewahrt, andererseits aber auch aus dessen Preisgeben, wenn es eben zu schulmeisterisch zu werden droht. Der zweite Punkt spricht für sich selbst, indem darin gerade das unselbständige Schaffen liegt. Es betrifft eben das veränderlich Charakteristische, "the altering fashion", das Individuelle, dasjenige, was einen Stil zu einem Stil macht. Denn mit dem Kopieren alter Formen wird die Originalität absolut preisgegeben. Der dritte Punkt endlich enthält nun gewissermassen die Antwort auf den zweiten, nämlich wie denn die neuen Formen sich gestalten sollen. Und diese Antwort kann selbstverständlich nur teilweise gegeben werden, indem man das Individuelle nicht vorschreiben kann. Aber wie war es denn, werden Sie fragen, in früheren Zeiten, als ja doch z. B. jeder dorische Baumeister gewissermassen dasselbe dorische Kapitäl machte, zwar mit geringen Abweichungen, Ausbesserungen, aber doch in der Grundform dasselbe? Und schlieslich sieht man in allen grossen Stilperioden doch keine so scharfen individuellen Abweichungen wie heutzutage. Sie haben recht! aber die Antwort auf diese Frage ist sofort zu geben. Der Unterschied zwischen jetzt und früher liegt eben darin, dass ein grosser Stil die Aeusserung eines ganzen Volkes ist und daher auf einer Tradition beruht, innerhalb deren das Individuelle verschwindet; dass hingegen eine Zeit ohne einen grossen Stil sich durch Individualisierung kennzeichnet, d. h. dass das Individuum sich geistig dem ganzen Volke mit seiner Tradition nicht untergeordnet fühlt, sondern jedes für sich Anspruch auf besondere Auszeichnung, auf Selbstäusserung macht. Solch eine Zeit ist eben eine Zeit selbständiger Schulen, auf die der führende Meister seinen Stempel drückt. In den Zeiten der grossen Stile kennt man solche Schulen nicht. Die Renaissance fängt damit an, denn es ist gerade der Humanismus, das Wort sagt es schon, der diese Weltanschauung fordert. Aus diesem Grunde war der gotische eben der letzte grosse Stil. In der heutigen Zeit ist der Individualismus wohl am stärksten ausgeprägt. Hatte man in der Renaissance-Zeit noch eine gewisse Tradition, die in der Antike wurzelte, heutzutage hat man gar keine. Jedermann für sich meint es allein zu wissen, und der Unbedeutendste will sich noch selbständig äussern ; wäre es in dem Fall nicht besser, wenn er rücksichtslos seinen Nachbar kopieren würde? Es ist aber gelungen zu beobachten, wie man eben das gar nicht verträgt, nur derselben Ursache wegen. Und was für Unheil diese Persönlichkeitsäusserung gestiftet hat (denn beim Fehlen einer Tradition will jederman originell sein, was einer Tradition gegenüber, und sei sie noch so schlecht, immer noch viel schlimmer ist), davon liefern leider unsere modernen Strassen den greulichsten Beweis. Die künstlerische Anarchie ist der grausamste Feind. Werden wir daher nicht wieder zu einem grossen Stil gelangen, bevor wir alle wieder nach einer gleichen Tradition arbeiten? -
Abgesehen nun von der Frage, inwiefern es möglich sein wird, dass alle Völker, die auf einer Kulturhöhe stehen, im selben Sinne arbeiten, kann man ganz ruhig diese Frage .mit einem "Nein" beantworten. Denn, was ist nicht alles dazu nötig? Bevor ich dazu jedoch die Schlussantwort gebe, muss ich erst wieder zum dritten Punkt zurückgehen, dass die architektonischen Formen sich nach der sachlichen Seite entwickeln sollen. Den nicht eigentlich individuellen Teil, der in dieser Forderung enthalten ist, kann man mit dem ersten Punkt, dem der geometrischen Grundlage verbinden, er soll der Einheit des Stils wegen mit jenem verknüpft werden. Ich habe Sie auf die geometrische Grundlage der beiden grossen Stile aufmerksam gemacht und Ihnen an einigen modernen Werken gezeigt, wie ein gewisses System, ein uniformes mathematisches Verhältnis, durch eine ganze Komposition durchgeführt werden kann. Es handelt sich hier um die eusssprechenden architektonischen Formen, d. h. Kapitäle, Gesimse, Leisten, kurz und gut, um die Verzierung im allgemeinen. Und da zeigt es sich, dass in dem geometrischen Plan die Triangulatur resp. Quadratur für diese Details ebenfalls die zugehörige Grundlage enthält, d. i. die Grundlage zu einer geometrischen Ornamentik. Ich zeigte Ihnen schon ein geometrisch gebildetes Kapitäl und andere geometrische Formen. Können nun schliesslich die beiden grossen Stile nicht ebenfalls geometrische Stile genannt werden nach dem Charakter ihrer Ornamentik? Denn kommt nicht in beiden, neben dem vegetabilischen, vorzugsweise ein geometrisches Ornament vor, und zwar im Anfang fast ausschliesslich? Ist das vegetabilische Ornament an dorischen Tempeln und an romanischen und gotischen Domen nicht verhältnismässig unbedeutend im Vergleich zum geometrischen, unbedingt vorwiegenden? Ist diese Tatsache nun nicht ein Fingerzeig für uns, wiederum damit anzufangen, unsere architektonischen Details von neuem geometrisch zu bilden, und dann für jede architekturale Komposition, je nach einem aparten Schema? Das bewahrt nebenbei sofort vor dem allzusehr persönlichen manchmal hässlich originellen Charakter, indem die geometrischen Formen nicht individuell und an und für sich immer schön sind. Mehr als diese Anregung kann man vorläufig nicht verlangen, denn die Ausarbeitung der Details muss wohl dem Individuum, jedem nach seiner Art und Weise, überlassen bleiben. Denn wie gesagt, eine einheitliche Grundform, auf die man sich geeinigt hat, gibt es vorläufig nicht - ein Säulenschema, das den dorischen Stil zum dorischen, den jonischen zum jonischen, den korinthischen zum korinthischen macht, gibt es nicht, und doch war es schliesslich nur ein einziges Kapitäl, das mit dem Akanthusblatt, das die formale Kunstumwälzung hervorrief und hunderte von Jahren überdauert hat. Die Geometrie aber ist in ihren Formen unendlich, d.h. unendlich viele Variationen sind nach einem einzigen Motiv möglich; und wenn man dann die Grenze nicht zu eng zieht, d. h. die von den streng geometrischen Linien abgeleiteten Formen, unter welchen die Spirale wohl die bedeutendste, und schliesslich den Begriff geometrischer Linien nicht allzu peinlich nimmt, dann wird man auf einmal sich den Blick dermassen erweitern sehen, dass man die Grenzen der ornamentalen Möglichkeit nicht bestimmen kann. Mehr als diese Anregung kann man vorläufig nicht verlangen, sagte ich oben. Ich hoffe nun, dass Sie das Wort Anregung nicht misdeuten werden, indem Sie darin vielleicht eine Vorschrift sehen, sich auf ein Ornament von Quadraten und Dreiecken zu beschränken. Ich kann nicht genug wiederholen, wie fern das liegen soll und wie immer die Geometrie nur Mittel und nicht Zweck bedeutet. Sie soll Mittel bleiben zur Bildung des eigentlich formalen Schönen, zur Bildung desjenigen, was einen Stil zu einem Stil macht. Und daraus geht wieder deutlich hervor, dass wir heutzutage, sogar bei Verwendung eines geometrischen Ornaments nichts anders als eine Anzahl individueller Stile zu erwarten haben; denn obgleich diese geometrische Grundlage an und für sich schon eine einheitliche Basis gibt, und diese das zu stark Individuelle wegnimmt, es ist doch zu erwarten, dass jeder Künstler für sich, jedes Ornament in andrer Weise, nach persönlicher Art entwickeln wird. Und die Beweise dafür sind schon da. Denn ist es nicht merkwürdig zu beobachten, wie die modernen Zierkünstler (und es ist ein ganzes Heer damit beschäftigt) zwar alle mehr oder weniger in geometrischen Formen, doch alle individuell arbeiten; einzelne nur in Quadraten und Dreiecken, andere wiederum in freieren Formen; wiederum andere mit Spiralen u.s.w.; aber trotzdem, gezwungen wie sie sind, fast unbewusst, wiederum zurückgedrängt, möchte ich sagen, zu dem Urquell eines richtigen Stilprinzips, zu der geometrischen Form. Es gibt aber Ausnahmen. Es gibt moderne Künstler, die sich von dem vegetabilischen Ornament nicht haben losreissen können, es im Gegenteil in ganz freier Formbehandlung benutzen. Hat denn ein solches Ornament keine Berechtigung mehr? Doch! Aber nur vom rein individuellen Standpunkt betrachtet, d.h. es wird mit dem Autor verschwinden, so wie das freie Linienornament gewisser Künstler; eben weil es einem persönlichen Geschmack entsprungen und daher nicht im Stande ist, zur Bildung eines formalen Stils etwas Bedeutendes beizutragen. Es bildet nur eine persönliche und daher eine vorübergehende Mode. Neben dem geometrischen Ornament hat es, wie gesagt, in allen grossen Stilen auch ein vegetabilisches gegeben, bald mehr, bald weniger vorwiegend. Man kann sich dem grossen stilistischen Reiz der Pflanzen nicht entziehen, umsoweniger als heutzutage wieder eine wachsende Liebe zur Natur bemerkbar wird. Es wird daher auch heutzutage die Pflanze ebenfalls zur Bildung von Ornamenten benutzt, aber sie wird nur dann einen stilistischen Wert haben, wenn sie sich der geometrischen Grundlage unterzuordnen versteht; und es ist nicht eine einzige Pflanze, sondern wiederum die ganze Pflanzenwelt, wie im Mittelalter, welche heutzutage von neuem das Interesse der Künstler erregt. Denn es wäre nicht denkbar, dass wie im egyptischen und griechischen Stil nur Palme und Lotos, und wie im römischen nur der Acanthus, heutzutage ebenfalls nur eine Pflanze allein im Stande wäre, das Grundmotiv zur Verzierung eines zukünftigen Stils zu liefern; geschweige denn zu den verschiedenen persönlichen Versuchen. Und trotzdem auch schon das Tier, und sogar der Mensch, in die Ornamentik hineingezogen werden, bleiben doch alle diese Versuche vorläufig zurück hinter dem geometrischen, dem gegenstandslosen Ornament, wie es van de Velde zu nennen pflegt. Nun, das ist nicht nur recht, sondern selbstverständlich, indem vorläufig noch jenes grosse "gewisse Etwas" fehlt, was in letzter Instanz einen Stil zu einem Stil macht, und das ist die Liebe zu einem Ideal. Rekapitulieren wir, dann haben wir als Vorbedingung zu einem architektonischen Stil die folgenden 3 Punkte:
1. Die Festlegung einer architektonischen Komposition geschehe auf geometrischer Grundlage.
2. Man soll die Formen früherer Stile nicht kopieren.
3. Die architektonischen Formen sollen ebenfalls geometrischer Natur sein, nach freier Auffassung, aber in einfachster, sachlicher Weise entwickelt, nach demselben Schema des Grund- und Aufrisses.
Durch diese drei Sätze achte ich den Stil, den wir jetzt zu befolgen haben, formuliert, indem ich nochmals besonders stipuliere, dass man jetzt wie früher, ein Künstler, nach wie vor ein schaffender Geist sein muss, um innerhalb dieses Grundgesetzes etwas Bedeutendes zu leisten, indem nur ein Künstler im Stande ist, das Gesetz, die ewige Wahrheit, d. h. den Geist vergessen zu machen, und durch dieses Gesetz, aus diesem Gesetz heraus, eine neue formale Schönheit zum Vorschein zu rufen. Die ewige Grundwahrheit, der Geist, war in der Stilarchitektur des 19. Jahrhunderts nicht vorhanden, er war verloren gegangen, und man hat nur die formale Schönheit früherer Zeiten, ohne diesen Geist, kopiert. Jetzt, da der Geist wieder gefunden ist, braucht man die formale Schönheit früherer Stile nicht mehr; im Gegenteil, jetzt soll man mit der Umbildung der Kunstformen, mit einer neuen Liebe anfangen. Diese Umbildung, mit der verschiedene Künstler sich jetzt schon seit einiger Zeit beschäftigen, kann heutzutage, wie ich sagte, nur individuell sein, so wie das auch in der Renaissance der Fall war. Das war die Ursache, dass die Renaissance zu keinem grossen Baustil gelangen konnte und weshalb auch heutzutage noch viel weniger an einen grossen Baustil zu denken ist. Denn ohne gemeinschaftliche Tradition kann von einem grossen Baustil nicht die Rede sein; Tradition war bei der Renaissance, durch die Nachbildung der Antike, noch vorhanden, aber heutzutage arbeiten die modernen Künstler absolut traditionslos, denn eine neue Tradition muss noch geschaffen werden. Die modernen Künstler werden sich nach vielem Suchen und Irren zuletzt zusammenfinden, gewissermassen eine künstlerische Uebereinkunft treffen. Aber wird dann schon der grosse moderne Stil geboren sein? Ich glaube kaum! Weil, wie ich sagte, vorläufig noch jenes grosse Etwas fehlt, das in letzter Instanz einen Stil zu einem grossen Stil macht, die Liebe zu einem Ideal. Man kann zwar sehr weit kommen, wenn man sich auf eine formale Schönheit geeinigt hat, wie z.B. das Akanthusblatt und mit ihm das korinthische Kapitäl ein treffliches Beispiel dazu gibt, aber da es nur eine formale Uebereinkunft war, konnte mittels ihrer Hilfe zwar ein Stil, aber kein grosser Stil erreicht werden. Denn jenes Schönheitsideal ist nicht formeller, sondern geistiger Natur, und die Kunst ist in letzter Instanz nur Abspiegelung geistiger Ideen. "Es ist einmal der Fall, dass die Kunst nicht mehr diejenige Befriedigung der geistigen Bedürfnisse gewährt", sagt Hegel, "welche frühere Zeiten und Völker in ihr gesucht und nur in ihr gefunden haben; eine Befriedigung, welche wenigstens von Seiten der Religion aufs innigste mit der Kunst verknüpft war. In allen diesen Beziehungen ist und bleibt die Kunst nach der Seite ihrer höchsten Bestimmung für uns ein Vergangnes." Scheffler, dessen Schrift "Konventionen der Kunst" ich schon zitierte, sagt, dass "alle Kunst, insofern sie Sprache der Seele sein will, auf Konventionen angewiesen ist und daran anknüpft", und etwas weiter: "Für die bildende Kunst ist eine allgemein gültige Konvention über die Grundidee des Lebens von grossem Wert". Also auch er hebt hervor, dass, wenn eine Kunst Sprache der Seele sein soll, sie es ohne Konvention nicht fertig bringt. Aber wie kann eine Kunst Sprache der Seele sein, wenn die Liebe nicht vorhanden ist? Und ist denn schliesslich eine Kunst wirklich eine Kunst, wenn sie keine Sprache der Seele ist? Prüft man also diese Aussprüche an dem Vorhergegangenen, dann wird man erst recht zu der Ueberzeugung kommen, warum es heutzutage vorläufig an einer grossen Kunst fehlt; aber es wird ebenfalls ersichtlich, weshalb bei der Stilarchitektur die Liebe fehlt und fehlen muss, indem wie erörtert von einer höheren Liebe bei der Wiederverwendung des äusserlich Formalen nicht die Rede sein konnte. Der zweite Satz Schefflers geht aber der Sache auf den Grund. Denn sogar, wenn die Künstler es so weit gebracht haben würden, dass sie sich auf die formale Schönheit, sowohl innerlich als auch äusserlich, geeinigt hätten, gewissermassen zu einer formalen Schönheitsübereinkunft gekommen wären; d. h. zu einem konsequent durchgeführten Formensystem auf geometraler Basis, dann noch würde in letzter Instanz keine grosse Stilarchitektur da sein, weil geistig jene grosse Uebereinkunft fehlt, welche ebenfalls eine Konvention fordert, eine Konvention, welche in der Kunst ihre Abspiegelung finden muss. Man kann es zwar mit der formalen Uebereinkunft weit bringen, die Kunst zu jener grossen Lebensfreude hinaufführen, die die Menschheit braucht und sie, so wie die Renaissance, auch gewissermassen befriedigen wird; aber jene letzte grosse Befriedigung, die Ruhe der Seele, kann sie nicht geben, wenn nicht ebenfalls die geistige Uebereinkunft getroffen wird. Und wenn Scheffler sagt, dass für die bildende Kunst eine allgemein gültige Konvention über die Grundidee des Lebens von grossem Wert sei, möchte ich behaupten, dass die bildende Kunst diese braucht, dass ohne sie ein grosser Stil nicht wachsen kann. Und ich glaube, dass jeder Künstler, wenn er sich nicht durch eine oberflächliche Betrachtung einerseits und durch sich selbst genugtuende Ueberschätzung andererseits hat betäuben lassen, zu dieser Erkenntnis kommen muss. Denn steht man in letzter Instanz nicht ohnmächtig da, wenn man sich formal, grosszügig ornamental, äussern will, eben weil gerade der Gegenstand, die ideale Grundidee, zu einer solchen Aeusserung fehlt? Und es gehört zur Selbsttäuschung, wenn man meint, dass die ideale Grundidee, die Religion, heutzutage noch dasselbe vermag wie früher, aus dem einfachen Grunde, dass auch bei ihr keine Uebereinkunft mehr gilt, eine solche wohl kaum mehr zu treffen ist, indess innerhalb der beiden grossen christlichen Religionen eine vielfache Zersplitterung stattfindet, und schliesslich, man kann sagen, was man will, auch im Gottesdienst heutzutage der eigentliche Geist fehlt und nur die formale Schönheit, die äusserliche Form übrig geblieben ist. Und es war eben die Reformation, die die Renaissance einläutete! Scheffler sagt dazu: "Die Geschlossenheit früherer Kunstepochen beruhte fast ausschliesslich darauf, dass die Menschen sich auf eine Religion geeinigt hatten, und die Zersplitterung in der künstlerischen Produktion der Gegenwart ist ebenso aus dem Fehlen einer allgemein anerkannten Weltidee zu erklären. Stil entsteht nur durch Beschränkung, bedarf als Grundlage eines Systems, ich stipuliere, ist selber System. Je bewusster die Menschheit wird, desto umfassender fordert sie dieses System. In ihm sollen viele Zweifel Antwort geben, und alle Widersprüche des Lebens aufgelöst werden. Es könnte von Interesse sein, tiefer auf diese Sache einzugehen, und es wäre für einen Geschichtschreiber, Kunstforscher, aber zugleich Künstler, ein sehr dankbarer Gegenstand, einmal in diesem Sinn Gedanken- und Formenschönheit als künstlerische Aeusserung zu studieren, und aus diesem Studium vielleicht eine Wertschätzung der verschiedenen Religionen zu ziehen." Ich hoffe nur, dass aus diesen Betrachtungen nicht die falsche Folgerung gezogen werde, dass die protestantische Religion als eine minderwertige zu betrachten sei, indem ihre künstlerische Äusserung eine minderwertige geblieben. Man soll sich immer davor hüten, Ursache und Folge zu verwechseln. Aber beachtenswert bleibt jedenfalls wiederum die Tatsache, wenn man nach der Ursache forscht, dass auch in diesem Zusammenhang die individuelle Äusserung wahrscheinlich als bezügliche Ursache zu betrachten ist, indem der Protestantismus für die individuelle Gedankenfreiheit den meisten Spielraum lässt. Es ist hier nicht der Ort, diese Ideen näher zu entwickeln oder auch nur den Versuch dazu zu wagen; sondern nur noch einmal diese Tatsache festzulegen, dass alle möglichen Gottesdienste zu allerhöchsten künstlerischen Äusserungen, imstande waren, weil die Menschen sich auf eine Religion geeinigt hatten. Mithin kann konstatiert werden, dass, was die geistige Liebe anbelangt, wir in einer Zeit leben, die zwischen zwei Religionen, d.h. geistigen Konventionen liegt und daher für die bildende Kunst unfruchtbar ist; "denn da kein Vertrag", wie Scheffler sagt, "über die Art des Ideals mehr gilt, weil gemeinverständliche Symbole ihm, dem Künstler, nicht zur Verfügung stehen, seine Empfindungen also aus sich heraus neue Gleichnisse suchen müssen, so bleibt er, weil dasjenige, was ihm seiner Erkenntnis nach, symbolisch erscheint, es andern aber nicht ist, unverstanden." Das klingt allerdings nicht sehr hoffnungsvoll. Es sagt also nicht mehr und nicht weniger als folgendes: "Was wir auch schaffen, wie wir auch ringen, wir können es höchstens zu einer Einigung in formaler Schönheit bringen, höchstens zu einem formalen Stil; aber zu einem Stil als Abspiegelung einer geistigen Idee, eines geistigen Ideals, nicht. Und ist es das nicht, was wir Kultur nennen? Es fehlt uns eine Kultur, denn Kultur setzt Solidaritätsgefühl voraus, kann sich nur auf einer geistigen Basis entwickeln, ist die Abspiegelung jenes geistigen Ideals. Es fehlt der Kunst ein gemeinverständliches Symbol, denn was dem einen seiner Erkenntnis nach noch symbolisch erscheint, ist es dem andern nicht, und die Kunst bleibt unverstanden. Mithin, wenn in letzter Instanz die Künstler sich schon auf eine gewisse formale Schönheit geeinigt hätten; so würde für diese formale Schönheit dennoch die geistige Grundlage, das Symbol, fehlen, und damit auch die befruchtende Idee. "Die Gegenwart lebt so zwischen zwei Zuständen, und alle Erscheinungen der neueren Kunst lassen sich einerseits auf das Fehlen der religiös-philosophischen Konvention zurückführen, andererseits auf die Sehnsucht danach", sagt Scheffler weiter, "in welches Dilemma sich die Künstler teilen. Die einen bedienen sich alter Formen, sowohl heidnischer wie christlicher, und suchen ihnen eine neue Erkenntnisform anzupassen; die andern, die sogenannten Nutzkünstler, versuchen eifrigst Tisch und Stuhl, Wohnhaus und Geschäftsgebäude, vernünftig zu konstruieren; aber diese Zweckgedanken sind im Grunde Kausalitätsidee, also Gottidee, und sind daher auf Unterströmungen zurückzuführen, welche von religiöser Sehnsucht bewegt werden". Es ist nun dieser letzte Satz, der als das Endergebnis betrachtet werden muss. Denn rekapitulieren wir noch einmal, dann kommen wir zur folgenden Betrachtung. Wenn man in der bildenden Kunst etwas schaffen will, was Stil haben soll, dann muss das Ganze nach einem mathematischen Grundschema aufgebaut sein und keine Form dabei der reinen Willkür entspringen; die Formen früherer Stile sollen jedenfalls nicht benutzt und daher beseitigt werden. Wenn man nach diesem Prinzip arbeitet, dann strebt man zuletzt einem formalen Stil zu, welcher Stil vorläufig noch des geistigen Impulses entbehrt, bis dass wieder eine Weltidee geboren sein wird. Deshalb ist die heutige moderne Bewegung nur als eine Formenumbildung zu betrachten, die nach der Erschlaffung des 19. Jahrhunderts kommen musste. Aber wenn nur diese moderne Bewegung in vernünftiger konstruktiver Form, d. h. im allgemeinen sachlich klar arbeitet, so wie es die beiden grossen Stile getan haben, dann arbeitet sie ebenfalls mit einer religiösen Tendenz, mit eine religiösen Sehnsucht, bis zuletzt die Sehnsucht Wirklichkeit und eine neue Weltidee geboren sein wird. Wie die neue Weltidee sich kundgeben, welches geistige Ideal ihr zur Grundlage dienen wird? Wer könnte darauf eine Antwort geben! Das Christentum ist tot, und von einer neuen Form universaler Weltbegriffe, wie sie in den Konsequenzen der naturwissenschaftlichen Forschung liegen müsste, ist kaum ein leiser Anfang zu spüren. Der Mensch verlangt aber eine gewisse ethische Befriedigung, und in dieser Beziehung kommt doch wohl aus all den Gärungen der heutigen Zeit dieser grosse Zug an die Oberfläche, dass es sich um einen altruistischen Kampf handelt. Es heisst doch entweder der einzelne, oder alle? Soll, mit der Verneinung der Moral, das Individuum allein, oder sollen, mit dem Gleichheitsprinzip, alle geschützt werden? Es ist hier wiederum nicht der Ort die Mehr- oder Minderwertigkeit eines solchen Prinzips auseinander zu setzen, aber nicht zu verneinen bleibt die grosse ethische Absicht des Strebens nach der ökonomischen Gleichheit aller Menschen; was zur Folge haben wird, dass sie dadurch geistig unabhängig werden, und mithin eine Ausnutzung alles geistigen Materials ermöglicht wird. Denn erst dann werden einerseits in dem geistigen Welt-Kampf die nämlichen Bedingungen gestellt sein, die zur Anstachelung der höchsten Kraftentfaltung nötigen, indem das geistige Resultat höher geachtet werden wird als jetzt das materielle; und andrerseits wird durch die gegenseitige geistige Vereinbarung das Resultat aufs höchste gesteigert werden, wogegen es jetzt, durch den lähmenden Einfluss des Kapitals mit dem daraus hervorgegangenen Klassenkampfe bis aufs niedrigste hinuntergeht. In meinem schon zitierten Vortrag "Gedanken über Stil" habe ich zu entwickeln versucht, wie der Kampf gegen die Stilarchitektur mit der Arbeiterbewegung zu vergleichen ist, indem der erste als eine geistige, die zweite als eine materielle Evolution einander parallel laufen, und dass erst die politische Evolution vollzogen sein muss, um die künstlerische zum Durchbruch kommen zu lassen, und dass von diesem Moment an erst an dem Wachstum eines Stils gearbeitet werden kann. Also: wenn die modernen Künstler sachlich klar arbeiten, mit den Vorbedingungen, die ich zu entwickeln versucht habe, alsdann werden sie auch dem modernen geistigen Ideal, dem ökonomischen Gleichheitsprinzip aller Menschen, zustreben, und dadurch der schon evolutionierten, formalen Schönheit den Odem einhauchen, das lebenbedingende Element, das in letzter Instanz ein Stil braucht, um sich zur Höhe emporzuschwingen. Unter sachlich klarer Arbeit verstehe ich das erneuerte Bewusstsein, dass die Architektur die Kunst der Raumumschliessung und daher auf den Raum, in architektonischer Beziehung, konstruktiv wie dekorativ, der Hauptwert zu legen ist und dass infolgedessen ein Gebäude nicht in erster Linie Manifestation nach aussen sein soll. Die Kunst des Baumeisters besteht darin, Räume zu schaffen; und nicht, Fassaden zu entwerfen. Eine Raumumschliessung wird durch Mauern hergestellt; daher manifestiert sich der Raum, oder verschiedene Räume, nach aussen als ein mehr oder weniger zusammengestellter Komplex von Mauern. Auf die Mauer fällt dabei in diesem Sinne wieder der gebührende Wert, dass sie ihrer Natur nach flach bleiben soll, denn eine zu sehr gegliederte Wand verliert ihren Charakter als solche. Unter sachlich klarer Arbeit verstehe ich, dass die Architektur der Wand Flächendekoration bleibe; dass die vorspringenden Architekturteile auf diejenigen beschränkt bleiben, welche durch die Konstruktion geboten werden, wie Fensterstützen, Wasserspeier, Rinnen, einzelne Gesimse u. s. w. Aus dieser sogen. "Architektur der Mauer," wobei die vertikale Gliederung von selbst wegfällt, folgt weiter, dass die eventuellen Stützen, wie Pfeiler und Säulen keine vorspringenden Kapitäle erhalten, sondern dass die Entwickelung der Uebergänge sich innerhalb der Mauerfläche abspielt. Die eigentliche Flächendekoration bilden die Fenster die natürlich nur dort anzubringen sind, wo nötig, und alsdann in den betreffenden verschiedenen Grössen. Unter sachlich klarer Arbeit verstehe ich eine solche, bei der die bildnerischen Verzierungen nicht vorherrschen und nur an der Stelle angebracht worden sind, welche zuletzt als Ergebnis des peinlichsten Suchens sich als die richtige herausgestellt hat. Dem Prinzip nach sollen sie Flachornamente bleiben, d. h. in der Mauer vertieft, und Figuren sollen schliesslich verzierte Mauerteile bilden. Man soll vor allen Dingen die nackte Wand wieder in all ihrer schlichten Schönheit zeigen. Unter sachlich klarer Arbeit verstehe ich eine solche, wobei alle Ueberladenheit aufs peinlichste vermieden ist, keine unnützen Gesimse und Leisten, Piedestale und Pilaster, Verkröpfungen und Aufsätze vorkommen, kurz alle jene Architekturteile parasitischer Natur. Unter sachlich klarer Arbeit verstehe ich schliesslich eine solche, die wiederum verstanden wird, wiederum Interesse erregt, indem nur natürliche Einfachheit und Klarheit dazu imstande sind, wogegen unnatürliche Kompliziertheit und Unklarheit unverstanden bleiben, stutzig machen, aber kein Interesse wachrufen und daher die Ursache wurden, dass die Baukunst, wie das im 19. Jahrhundert der Fall war, ausserhalb der kulturellen Bewegung geschoben wurde. Die sachliche, vernünftige und daher klare Konstruktion kann die Basis der neuen Kunst werden; und erst dann, wenn jenes Prinzip genügend durchgedrungen ist und auch allgemein verwendet wird, werden wir an der Pforte einer neuen Kunst stehen; aber auch in demselben Moment wird das neue Weltgefühl, die gesellschaftliche Gleichheit aller Menschen manifestiert sein, ein Weltgefühl, nicht mit seinem Ideal eines Jenseits, d.h. nicht in diesem Sinne religiös, sondern mit seinem Ideal von dieser Erde, also jenem entgegengesetzt. Aber wäre denn schliesslich damit nicht das Endziel aller Religionen näher gerückt, die christliche Idee nicht verwirklicht? Oder ist nicht die ganze christliche Lehre eben auf diese eine Gleichheit für alle Menschen zurückzuführen die erste Bedingung eines idealen Strebens? Dann wird die Kunst wieder eine geistige Basis haben, die sie braucht, um sich als vollbewusste Äusserung dieses Weltgefühls manifestieren zu können, indem sie dann auch ihre Kunstsymbole haben wird, die der formale Stil als Abspiegelung der geistigen Idee braucht. Dann wird aber auch das architektonische Kunstwerk nicht einen spezifisch individuellen Charakter haben, sondern das Resultat der Gemeinschaft, in diesem Sinne aller, sein; dass bei der Führung des Meisters, des geistig Hervorragenden, aber jeder Arbeiter ebenfalls geistig daran mitarbeiten kann. Denn obschon wir wissen, dass in den grossen Stilperioden, ausser der des Mittelalters, diese Art des Zusammenwirkens nicht existierte: heutzutage weiss man, dass das geistige Interesse des Arbeiters an seiner Arbeit völlig fehlt. Das Verschwinden dieser Idee, des pedantischen Gefühls des Individuums, zugunsten der eigentlichen Arbeit, als Äusserung nicht einer Person, sondern eines Zeitgeistes, dessen Dolmetscher der führende Künstler ist, scheint heute kaum bekämpft werden zu können; und trotzdem wird wie von selbst das Individuum zugunsten nicht der Gemeinschaft, sondern der Idee in den Hintergrund gedrängt werden, so wie das früher der Fall war. Denn wer fragt schliesslich nach dem ersten Baumeister einer mittelalterlichen Kathedrale, wer nach dem Namen eines ägyptischen Architekten; man kennt allein die Namen der Herrscher, unter deren Regierung die Bauwerke entstanden. Wie dem auch sei, wir können konstatieren, dass ein Anfang mit dem langen Weg gemacht ist, der zu einem architektonischen Stil führt, einem Wege, von dem ich glaube, dass von ihm keine Seitenwege mehr abbiegen werden. Und wenn ihr Architekten in obigem Sinne arbeiten werdet, muss dieser Weg zu einem hohen Stil führen, so wie das früher der Fall war. Es scheint sogar, dass die Architektur die Kunst des 20. Jahrhunderts sein wird, eine Ueberzeugung, die ich ebenfalls aus den gesellschaftlichen und geistigen Erscheinungen der Gegenwart heraushole. Denn mit dem Wachstum der Arbeiterbewegung wächst auch jene Kunst, die der Mensch, das ganze Volk zusammengenommen, am wenigsten entbehren kann, die ihm am nächsten liegt, und das ist die Baukunst. Die Baukunst wird dann wieder den ersten Rang, unter den Künsten einnehmen, gerade weil sie die eigentliche Volkskunst ist, nicht die Kunst des einzelnen, sondern die Kunst aller, die Kunst der Gemeinschaft, in der sich der Zeitgeist wiederspiegelt; denn zur Herstellung eines Bauwerks ist doch die ganze Nutzkunst und mit ihr sind doch alle Arbeiter nötig. Sie fordert ein Zusammenwirken aller Kräfte; und diese können nur geistig verwendet werden, bei ökonomischer Unabhängigkeit aller. Sie, die Baukunst, ist die Manifestation des äussersten Könnens eines ganzen Volkes. Denn nur beim Zusammenwirken aller Kräfte zu einem idealen Zweck kann jene staunenswerte Vollkommenheit erreicht werden, die das Geheimnis der höhern Baukunst ist, und deswegen vom Individuum allein nicht erreicht werden kann. Arbeitet ihr Architekten in dieser Richtung, dann muss die Baukunst wieder die bildende Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts sein, sowie sie es das, letzte Mal vor sechs Jahrhunderten gewesen ist, wobei die Malerei und Skulptur wieder ihr dienend zur Seite schreiten werden, und, also verwendet; zur höhern Entwickelung gelangen können; sie werden aber ihren Charakter von heute, als Gemälde und Salonfigur, verlieren, eben weil diese prinzipiell eine geistig niedriger stehende Kunst vergegenwärtigen und daher erst in zweiter Linie kommen; eine Prophezeihung, die aus der gesellschaftlichen und künstlerischen Evolution der Gegenwart hervorgeht; kann man doch schon beobachten, wie mit dem Wachstum der Nutzkunst diese an Interesse gewonnen hat, und das Interesse für Staffeleibild und Salonfigur jährlich abnimmt. Es herrscht ein Streben nach Einheit in der Vielheit, nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Gemeinschaft, nach Ordnung, also wieder nach einem hohen Stil. Ich finde es schön, auch von Stil in der Gemeinschaft reden zu können, also von Kultur. Die Künstler der Gegenwart stehen jetzt vor der schönen Aufgabe, die künstlerische Verschönerung, d. h. den grossen architektonischen Stil jener zukünftigen Gemeinschaft formal vorzubereiten. Sie werden sich allmählich zusammen finden, trotzdem sie jetzt noch ein Einsamkeitsgefühl spüren werden, ein Gefühl, das das charakteristische Merkmal eines jeden religiösen Interregnums bildet; sie werden deswegen beschimpft, indem sie Träger von Kunstideen sind, die ausserhalb der breiten Masse stehen, aber die kommenden Zeiten vorausfühlen. Eine schönere Arbeit gibt es wohl nicht, denn jene Zeit wird dann wieder eine Kultur haben und daher Aufgaben stellen, so schön, wie sie noch nicht da gewesen sind; denn um so viel geistig höher jene Zeit der mittelalterlichen und allen vorangegangenen sein wird, indem ihr Ideal, die gesellschaftliche Gleichheit aller Menschen, an einer höhern Stelle stehen wird, um so viel schöner wird auch ihre künstlerische Abspiegelung, werden ihre architektonischen Monumente, wird ihr ganzer Stil sein. Die glauben, übereilen sich nicht. Denn mag es auch einerseits traurig sein zu wissen, dass wir von jener Zeit nichts mehr sehen werden, andererseits bleibt der Trost des Traumbildes, das wir schon am Horizonte heraufdämmern sehen, und das uns von neuem in jene Zeit versetzt, wo Ulrich von Hutten ausrief:
Es ändert sich die Zeit,
Die Geister regen sich.
Es ist eine Lust zu leben!