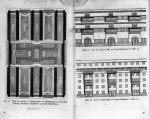| |
|
Was ich heute
vorstelle, sind eigentlich keine Ergebnisse, sondern eher Desiderate einer
Forschung, die noch aussteht. Für manche der Behauptungen, die ich im
Folgenden aufstelle, werde ich den Nachweis schuldig bleiben. Ich will
versuchen, ein Problem zu umreißen und werde dabei manchen Aspekt nur
flüchtig behandeln
– das nur als Warnung vorweg.
Mein Interesse gilt der Frage nach der Aufeinanderbezogenheit von privatem
Interieur und öffentlichem städtischen Raum in der Konzeption der modernen
Stadtvision. Bisher wurde diese Stadtvision der Moderne von
Geschichtsschreibung und Kritik zumeist entweder unter funktionalen und
sozialen Aspekten (Minimalwohnung, Hygiene, Verkehr, etc.) oder im Hinblick
auf den Stadtraum, bzw. dessen Auflösung betrachtet. Inwiefern die Form der
Minimalwohnung mit der Form des Stadtraumes verbunden ist, oder besser
gesagt: dass die Verbindung von privater Wohnung und öffentlichem Raum nicht
zuletzt als die Lösung eines Formproblems zu verstehen ist, blieb dabei
unbeachtet.
So ist auch im Prospekt zu dieser Tagung im Zusammenhang mit der Architektur
der Moderne von der „Entgrenzung des Gebäudes“
die Rede. Diese Interpretation der modernen Stadtvision ist zu einem
Allgemeinplatz geworden, und sie trifft die Symptome sicher ganz gut, aber
sie nennt die Ursachen nicht (zumindest wenn von den Idealstadtvisionen der
Moderne die Rede ist und nicht von den ungeplanten Phänomenen – Sprawl etc.
–, die sicher anderen Gesetzmäßigkeiten folgen). Meines Erachtens müsste man
die vermeintliche „Entgrenzung des Gebäudes“ eher als den Versuch betrachten,
ein neues proportionales Gefüge von Interieur und Exterieur zu schaffen. Das
heißt für die Interpretation der modernen Idealstadt à la Le Corbusier, dass
nicht so sehr die Auflösung der Hausgrenzen und des Stadtraumes
unsere Aufmerksamkeit beanspruchen sollte, als vielmehr der Versuch, die
Räume des Hauses und die Räume der Stadt in ein neues Verhältnis zu bringen.
Das Reden von der Entgrenzung ist hierbei von begrenztem Nutzen, denn die
Wohnung bzw. das Gebäude auf der einen Seite und der Stadtraum auf der
anderen Seite bleiben ja dennoch eigenständige konzeptionelle Einheiten.
Auch wenn die neue Anordnung von Gebäude und Stadtraum mit dem
traditionellen Stadtgefüge nichts mehr gemeinsam hat, gibt es gleichwohl
einen konzeptionellen Zusammenhang von Interieur und Exterieur. Wie sich
dieser Zusammenhang allmählich verändert hat und welche Rolle das private
Interieur bei der Konzeption des städtischen Raums spielen kann, möchte ich
im Folgenden skizzieren – auch wenn das keine einfache Aufgabe ist, denn nur
in seltenen Fällen findet man in der Architekturtheorie konkrete Aussagen
dazu, wie die Räumlichkeit des privaten Interieurs von der Räumlichkeit des
Kontextes abhängt.
Zu den wenigen Autoren, die sich dieser Frage angenommen haben,
gehören Hermann Muthesius und Le Corbusier; anhand ihrer Konzeptionen möchte
ich zeigen, dass diese Frage unsere Aufmerksamkeit verdient. Doch zunächst
werde ich versuchen nachzuvollziehen, wie die Dimensionen des Wohnraums
überhaupt zum Gegenstand der Diskussion werden. Ich beginne mit einem
kurzen, allgemeiner gehaltenen Überblick (der sicher einige Zusammenhänge
allzu sehr vereinfacht; ich bitte dafür um Entschuldigung).
Die gegen Ende des 19. Jahrhunderts laut werdende Kritik am Historismus ist
– was die Wohnvorstellungen angeht – eine Kritik am „Palaststil“, also an
der neureichen Protzerei der Gründerjahre. Mit dieser Kritik geht eine
Überprüfung der tatsächlichen Wohnbedürfnisse einher, etwa durch Reformer
wie Hermann Muthesius oder Albert Gessner. Diesen Reformern geht es zunächst
nicht um die Wohnverhältnisse der Massen in den großen Städten, sondern –
mehr oder weniger unabhängig von allzu drückenden ökonomischen Zwängen – um
die bürgerliche Wohnung. Das erzieherische Moment im Selbstverständnis der
Architekten bezieht sich auf den Geschmack seiner Klientel und hat sich noch
nicht zu dem Verlangen ausgewachsen, mit einer neuen Stadtform zur Schaffung
einer neuen Gesellschaftsform beizutragen. Dieser Schritt erfolgt erst nach
dem Ersten Weltkrieg. Vor dem Ersten Weltkrieg, 1909, schreibt der Berliner
Architekt Albert Gessner in seinem Buch über Das deutsche Miethaus
in einem Abschnitt mit dem bezeichnenden Titel
„Ungeschultes Bedürfnis des Mieters“:
„Leider, leider verlangt der
Mieter noch immer die prunkenden Vorderzimmer, begnügt sich mit den
kümmerlichsten Schlafzimmern, mit den dürftigsten Nebenräumen, wenn er nur
den Salon besitzt und den „Speisesaal“, der sich für Gesellschaften eignet.“
Und Gessner beklagt:
„Ueberladung gilt für
vornehm, und irgendwelches Gefühl für Raumwirkung ist nicht vorhanden. Der
Durchschnittsmieter findet ein Badezimmer von 6 Meter Länge, 1,20 Meter
Breite und 4 Meter Höhe groß und schön. Dass Länge, Breite und Höhe eines
Raumes in einem Verhältnis zu einander stehen müssen, darüber geben sich
wohl die meisten Menschen keine Rechenschaft.“
Auch für das Äußere
verlange der Mieter nach einem „palastartigen Eindruck“.
Gessner will für
die Qualitäten des Raumes sensibilisieren, die Frage nach dem Verhältnis von
Innenraum und Stadtraum spielt dabei aber noch keine Rolle. Es geht eher
darum, an Stelle der Aufgeblasenheit der historistischen Interieurs eine
ehrliche und selbstbewusste Wohnform für das Bürgertum zu finden.
In diesem Zusammenhang gewinnen funktionale Überlegungen an Bedeutung, und
so entwickeln sich allmählich die grundlegenden Vorstellungen von den
Qualitäten einer modernen Wohnung. Es sind diese Überlegungen, die auch für
die späteren Bemühungen um den Arbeiterwohnungsbau das Instrumentarium
liefern: Als nach dem Ersten Weltkrieg die Wohnung für das Existenzminimum
zum Gegenstand der Untersuchung wird, ist die erforderliche entwurfliche
Herangehensweise bereits weitgehend entwickelt.
Wichtig ist zunächst: Mit der Abkehr vom Palaststil oder vielmehr vom
Klassizismus allgemein, wird nicht nur der Formkanon aufgegeben, auch
die damit verbundenen Raumvorstellungen haben ihre Gültigkeit
verloren. Für einen Architekten wie Gessner, der nach einer neuen
Formensprache sucht und in Berlin zahlreiche Miethäuser ohne
historisierendes Dekor errichtet, tritt ein pragmatisches Verhältnis zum
Raum an die Stelle des wilhelminischen Imponiergehabes. Gessner schreibt:
„Die Höhe der Räume sollte im
allgemeinen das richtige Verhältnis zu ihrer Grundfläche haben, und das
würde in jedem Falle auch für die Miethauswohnung in hygienischer Beziehung
genügen. […] Eine lichte Höhe von 3 m bis 3,5 m müßte im allgemeinen für
unsere gewöhnlichen Zimmergrößen vollkommen genügen. Die Uebertreibung in
der Höhe der Räume hat ja ihren Höhepunkt schon überschritten, man hat
eingesehen, dass mit der Vergrößerung der Höhe nicht auch einfach die
Gesundheitsförderung zunimmt. Es soll eben in allen Dingen ein Maß sein.“
Gessner verlässt sich auf den gesunden Menschenverstand, aber es gab auch
Theoretiker, die sich Gedanken darüber gemacht haben, ob es nicht
Idealproportionen jenseits der palladianischen Tradition gibt – Ideale, die
sich wissenschaftlich, das heißt: physiologisch-experimentell begründen
lassen. Ich denke hier in erster Linie an Hermann Maertens und seine Theorie
Der Optische-Maassstab von 1877.
Maertens beruft sich auf die Erkenntnisse von Hermann Helmholtz. Helmholtz
hatte die Wahrnehmungsbedingungen des Auges untersucht und festgestellt,
dass nur jeweils ein ganz kleiner Teil des Gesichtsfeldes wirklich scharf
gesehen und klar wahrgenommen wird: und zwar etwa eine Winkelminute (Man
kann das überprüfen, indem man einen Arm ausstreckt und versucht, den
eigenen Daumennagel zu fixieren; man wird dann feststellen, dass es nicht
möglich ist, eben mehr als diesen Daumennagel scharf zu sehen). Darüber
hinaus öffnet sich das Gesichtsfeld etwa 27 Grad nach jeder Seite, außerhalb
davon wirkt alles mehr und mehr verzerrt.
Diese Erkenntnisse macht sich Maertens zunutze. Er entwickelt daraus Regeln
für die Proportionierung sowohl des Baukörpers einschließlich der Details
(Gesimse etc.) als auch der Stadt- und Innenräume. Er untersucht, wie klein
die kleinsten Glieder bei Gesimsen und Ornamenten sein sollen, wenn man von
einem Sehstrahl von einer Winkelminute ausgeht. Bei Innenräumen kommt es ihm
darauf an, dass der Betrachter den ganzen Raum als ein harmonisches Ganzes
wahrnehmen kann. Dafür darf die Decke nicht zu niedrig sein, denn dann nimmt
sie zu viel von unserem Raumbild ein und wirkt drückend. Wenn sie aber zu
hoch ist, dann beherrschen die Wände der Schmalseite das Raumbild, so dass
der Raum wiederum einen unproportionierten Eindruck macht. Aus diesen
Annahmen entwickelt Maertens ein Regelwerk, das – in Tabellen
zusammengefasst – in der Praxis leicht anzuwenden ist.
„Der optische Maßstab“, das bedeutet die Analyse von räumlichen Qualitäten
auf Grundlage unserer Wahrnehmung, und insofern ist Maertens’
Herangehensweise sicher ein Fortschritt, auch wenn diese Art der
Raumbetrachtung noch immer einige Defizite aufweist: Maertens geht allein
vom Sehen aus, die Bewegung im Raum spielt für ihn allenfalls eine
untergeordnete Rolle. Maertens meint, dass der Betrachter instinktiv einen
geeigneten Blickpunkt im Raum sucht und sich zu diesem hinbewegt, dann aber
dort verharrt und den Raum in sich aufnimmt. Dieser Standpunkt ist immer
derselbe: Der Betrachter steht an einer der Querwände und hat die
gegenüberliegende Querwand im Blick, sieht also in die Tiefe das Raumes.
Dazu Maertens:
„Wir treten durch eine Thür auf der
Langseite eines oblongen Saales in denselben ein. Kaum jedoch haben wir
unser Auge erhoben, da zieht es uns von selbst nach der schmalen Seite des
Saales, um den Innenraum überschauen und in seiner Harmonie geniessen zu
können.“
Maertens errechnet für Räume, die harmonisch gestimmt sein sollen, bei einer
Länge von 4,50 m eine Höhe von 3,10 m bis 3,20 m, für einen Raum mit einer
Länge von 6 m eine Höhe von 3,60 m bis 3,80 m. Insofern dürften die meisten
damals gebauten Räume tatsächlich zu hoch gewesen sein. Maertens liefert nun
Regeln, die eine Abkehr von den gründerzeitlichen Raumdimensionen auch
ästhetisch wohlbegründet erscheinen lassen. Als praktische Raumästhetik war
Maertens um 1900 ›state of the art‹: Man vergleiche dazu aus dem Handbuch
der Architektur das Heft über Wohnhäuser, das Karl Weißbach 1902
herausbringt. Weißbach nennt Maertens’ Regeln „[v]ortrefflich“
und verwendet sie ausgiebig.
Man muss allerdings sagen, dass Maertens’ Prinzipien eher für große Räume
gedacht waren. Jedenfalls waren derartige Überlegungen für Wohnräume in der
Stadt in der Regel kaum erforderlich, denn hier nahmen die Bauordnungen dem
Architekten doch häufig die Entscheidung über die Raumhöhe ab – man ging von
hygienischen Erfordernissen, sprich: vom Luftvolumen aus, und nicht von
Wahrnehmungsaspekten. – Und noch ein Aber: Auch Maertens sucht doch
letztlich auch wieder nach absoluten Proportionsregeln: die einmal
ermittelten Idealproportionen gelten unter allen Bedingungen; sie sind
unabhängig von der Räumlichkeit des Ortes.
Dennoch war Maertens’ Theorie ein Meilenstein, der heute zu Unrecht
vergessen ist. Den nächsten Fortschritt verdanken wir Hermann Muthesius,
dessen Schriften über Das Englische Haus zu Beginn des 20.
Jahrhunderts zweifellos den größten Einfluss auf die Entwicklung des
Wohnhausbaus in Deutschland hatten. Mit seinen Ideen kommen wir zu unserem
eigentlichen Thema: Denn Muthesius vertritt eine gänzlich andere, nämlich
eine kontextbezogene Position zur Frage der Innenraumproportion.
Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist das englische Landhaus. Er hatte in
England in offiziellem Auftrag die englische Wohnweise untersucht und preist
diese nun als Vorbild für die Wohnbedürfnisse seiner eigenen Landsleute an.
Ich will auf die funktionalen Aspekte, die dabei im Vordergrund stehen,
nicht näher eingehen.
Nur soviel: die Stilfrage stellt sich auch für Muthesius nicht mehr, und so
kann er auch die Räume frei nach funktionalen Kriterien anordnen und
dimensionieren, ohne sich den Restriktionen eines Formenkanons unterwerfen
zu müssen. Aber wie gesagt: in unserem Zusammenhang verdient Muthesius aus
einem anderen Grunde besondere Aufmerksamkeit: Er ist, soweit ich sehen
kann, damals der einzige, der immer wieder darauf hinweist, dass die
Proportionen des Wohnraums davon abhängig sind, ob sich das Haus oder die
Wohnung in der Stadt oder auf dem Land befindet. Das macht für ihn einen
großen Unterschied. Hören wir, was Muthesius dazu in seinem Essay „Über
häusliche Baukunst“ von 1904 zu sagen hat (die Hervorhebungen sind von mir):
„Aber auch noch in einer anderen,
rein praktischen Beziehung hat unsere städtische Etagenwohnung die
Vorstadtvilla, und nicht zum Vorteil der Sache, beeinflußt, nämlich in den
Höhen- und Grundrißmaßen der Räume. Wer beide Wohnarten, die in einer
Etage und die in einem Einzelhause, kennen gelernt hat, der wird sich bewußt
geworden sein, dass die Etage größere und höhere Räume verlangt als das
freiliegende Haus. Größere Räume deshalb, weil im Einzelhause sofort
eine Bewegungsfreiheit im Garten, Vorgarten, auf den Treppen, ja selbst auf
der Straße für den Bewohner gegeben ist, die die Etage nicht gewährt.
Schließt man dort die Flurtür hinter sich, die nach dem schon zur
Öffentlichkeit gehörenden Treppenhause führt, so ist man auf das [sic]
Bereich des Etagengrundrisses eingesperrt. Man entschließt sich nicht
leicht, auf die Straße zu gehen, um sich einige Schritte Bewegung zu machen.
Dafür muß eine gewisse Geräumigkeit der Wohnung entschädigen. Diese
Maße nun aber auch auf das Einzelhaus zu übertragen, ist in den meisten
Fällen ein überflüssiger Luxus. […] Dasselbe gilt von der Höhe der Räume.
Die an und für sich schlechtere Luft der Großstadt verlangt eine
entsprechend größere Luftmenge, daher wünschen wir mit Recht die Räume
unserer Stadthäuser möglichst hoch zu haben. Diese Höhe dann aber auch in
dem im Walde oder im Freien liegenden Landhause anzuwenden, ist zum
mindesten überflüssig. Gegen sie spricht noch der ästhetische Gesichtspunkt,
dass hohen Räumen nur sehr schwer ein trauliches, heimisches Gepräge zu
verleihen ist, niedrige dies aber in der Regel von selbst annehmen. Und was
die Kosten anbetrifft, so verschlingt diese überflüssige Höhe Summen, die,
wenn sie ausgegeben werden sollen, weit besser auf die Steigerung wirklicher
Bequemlichkeiten verwendet werden könnten.“
Muthesius war mit seinen Ideen zum modernen Landhausbau ausgehend vom
englischen Haus sehr einflussreich, aber diese ausgesprochen bemerkenswerte
Überlegung zur Notwendigkeit, die Räumlichkeit von Stadt- bzw. Landhäusern
zu unterscheiden, wurde offenbar überhört.
Dabei hatte er mehr als einmal davor gewarnt, den Kontext zu vergessen und
nun das Landhaus zum allgemeingültigen Ideal zu machen – dazu hier ein
weiteres Zitat von Muthesius aus seinem Hauptwerk Das englische Haus.
Diesmal argumentiert er anders herum, ausgehend vom Landhaus, dessen
Grundsätze in England fälschlicherweise auf die Stadt übertragen werden (die
Hervorhebungen sind wieder von mir).
„Ein andrer Fehler, der zumeist [in
England] begangen wird, ist der, die Wohnräume in den neuen Etagenhäusern
durchweg zu klein zu bilden, eine ungerechtfertigte Übertragung einer
Eigentümlichkeit des kleineren englischen Hauses auf die Etage. Denn es
unterliegt keinem Zweifel, dass kleinere, niedrigere Räume im Einzelhause
ebenso statthaft sind, wie die Etagenwohnung große, hohe Zimmer erfordert.
Das Einzelhaus bringt den Bewohner viel mehr mit der Natur in Berührung und
gibt ihm Bewegungsfreiheit in diese hinaus, während der Etagenbewohner seine
ganze Welt hinter der Korridortüre seiner Wohnung aufschlagen muß. Außerdem
erlaubt die frische, gesunde Landluft eine geringere Luftmenge und damit
geringere Stockwerkshöhen, als die verdorbene Luft der Großstadt. Es ist nun
lehrreich zu beobachten, wie man in England, wo sich Zimmergröße und
Stockwerkshöhe am Landhause entwickelt haben, diese Eigentümlichkeit in
derselben falschen Weise auf die Etage überträgt, wie man in Deutschland, wo
die Etagenwohnung das Maßgebliche war, das sehr große und hohe Zimmer der
Etage auf das kleinere Landhaus verpflanzt. In London wird sich die größere
Zimmergrundform in der Etage mit der Zeit ebenso einfinden, wie in
Deutschland das kleinere und niedrigere Zimmer im Einzelhause mehr und mehr
Aufnahme finden wird, wenn diese Grundformen der Wohnung erst selbstständig
geworden sind.“
Es blieb ein frommer Wunsch, dass seine Zeitgenossen die grundsätzliche
Verschiedenheit von Stadt- und Landleben einsehen würden und sich
schließlich zwei unterschiedliche Wohnwelten herausbilden würden: eine
städtische und eine ländliche. Und nach dem Ersten Weltkrieg war die Zeit
der großbürgerlichen Stadtwohnungen und der Landhäuser nach englischem
Vorbild allemal vorbei. Ich komme auf diese Entwicklung gleich zu sprechen.
Doch zuvor muss ich noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen, der bereits zu
Anfang im Zitat von Gessner angeklungen ist: die Frage der Hygiene, die bei
der Proportionierung der Räume berücksichtigt werden musste. So kann es auch
Muthesius nicht bei dem ästhetischen Argument bewenden lassen. Auch wenn für
ihn die ästhetische Frage eindeutig im Vordergrund steht, kommt er nicht
umhin, den Leser davon zu überzeugen, dass sich die Forderungen der
Gesundheitspflege durchaus mit denen der Ästhetik decken und seine räumliche
Idealvorstellung auch hygienisch einwandfrei ist – dazu im Detail noch
einmal Muthesius:
„Der Grund für die Niedrigkeit der
Räume ist vorwiegend ein ästhetischer; sie sichert einen wohnlichen Eindruck
des Zimmers und läßt dessen Grundfläche größer erscheinen. Die niedrige
Zimmerhöhe wird jedoch auch gesundheitlich für vollkommen zulässig gehalten,
und die hervorragenden englischen Gesundheitslehrer stehen heute ganz auf
der Seite der ästhetischen Vertreter des niedrigen Raumes. […] Als
wesentlich wird dabei allerdings betrachtet, dass das Fenster bis dicht
unter die Decke reicht, damit beim Öffnen wirklich alle verbrauchte Luft
entweichen kann. Die Luftschicht, die zwischen der Fensteroberkante und der
Decke liegt, wird als nutzlos angesehen, weil sie an dem Luftwechsel nicht
teilnimmt und also eine Speicherschicht für unkontrollierbare Ansammlungen
wird. Überschreitet nun, so sagt man, die Höhe des Zimmers 10 Fuß, so wird
das Fenster, wenn man es wirklich bis an die Decke reichen läßt, nicht mehr
hantierbar und wird daher von den Dienstboten in der Regel gar nicht mehr
geöffnet, wodurch es nutzlos wird. Es kommt hinzu, dass der oberer Teil der
Wände hoher Zimmer nie gereinigt zu werden pflegt und dadurch für
Ablagerungen von Schmutz Gelegenheit bietet. […] Man ist […] heute in
England der Ansicht, dass niedrige Zimmer, so lange bei ihnen nur für den
Luftwechsel gesorgt wird, sogar gesünder sind als hohe, und diese Ansicht
findet neuerdings ihre praktische Anwendung nicht nur bei Wohnräumen,
sondern auch bei solchen Räumen besonderer Art, bei deren Gestaltung
gesundheitliche Forderungen geradezu die Richtschnur abgeben, z. B. bei
Schulen und Krankenhäusern.“
Die Argumente, die Muthesius hier anführt, waren keineswegs neu. Der naive
Glaube, dass der Hygiene genug getan sei, wenn nur in der Stadtwohnung mehr
Luftraum vorhanden sei, wird damals allgemein in Frage gestellt. Auch andere
Autoren erklären, dass der Luftraum in der Wohnung nicht mehr separat
betrachtet werden kann; er allein ist kein Garant für Gesundheit. Rudolf
Eberstadt wendet sich in seinem weit verbreiteten Handbuch
des Wohnungswesens und der Wohnungsfrage
gegen unnötige Zimmerhöhen gerade bei kleinen Wohnungen. Auch sein
Argument lautet, dass der Luftraum nicht erneuert wird; er bildet gleichsam
eine Unheil verheißende Wolke, die sich niemals verzieht. Eberstadt
schreibt:
„Die Lufterneuerung ist bei der
Kleinwohnung aus naheliegenden Gründen noch viel notwendiger als bei der
herrschaftlichen Wohnung. Auch die in der Mietskaserne etwa vorhandene
größere Zimmerhöhe wird durch den Mangel an Querlüftung eher in einen
Nachteil verwandelt; der über der Fensteroberkante lagernde Luftwürfel kann
sich niemals erneuern und wird geradezu zum Träger verdorbener Luft.“[13]
Auch er
argumentiert, dass die Luft oberhalb der Fenster nicht genügend ausgetauscht
wird und daher viel eher ein Krankheitserreger ist, als ein Heilmittel. Das
hygienische Argument für die in den Mietskasernen üblichen Zimmerhöhen galt
nicht mehr viel. Der Luftaustausch und nicht die Luftmenge war entscheidend,
und so ging es in der Diskussion auch mehr und mehr um einen Stadtgrundriss,
der eine entsprechende Durchlüftung gewährleistet.
Vor dem Ersten Weltkrieg blieben dahingehende Versuche einer Neuordnung der
gesamten Blockstruktur noch verhalten. Das Wissen um die Probleme war
vorhanden, aber erst nach dem Ersten Weltkrieg nehmen diese Probleme solche
Ausmaße an, dass keine andere Wahl blieb, als nun tatsächlich eine Revision
der gesamten Stadtstruktur in Angriff zu nehmen. Ich brauche wohl die Gründe
für die Revolution im Wohnungsbau nicht noch einmal darzulegen. Die heile
Welt von Muthesius ist untergegangen, die Zeit verlangt nach anderen
Lösungen (was Muthesius zu den Wohnqualitäten des Landhauses zu sagen hatte,
bleibt aber dennoch grundlegend für die weitere Diskussion).
|

Abbildung 1
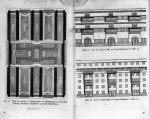
Abbildung 2
|
|
Einer der interessantesten und zugleich
einer der frühesten dieser Versuche, durch radikales Umdenken einen Weg aus der
Wohnungsnot zu finden, stammt von Heinrich de Fries, der bereits mit Peter
Behrens ein Buch Vom sparsamen Bauen. Ein
Beitrag zur Siedlungsfrage
(Berlin 1918) herausgebracht hatte. De Fries beruft sich in seiner kleinen
Schrift Wohnstädte der Zukunft von 1919 auf die oben zitierte Aussage
Eberstadts
und entwickelt einen Maisonettewohnungstyp, der auf kleinsten Raum bieten
soll, was ein kleines Haus auch bietet: Ein zweigeschossiger Hauptraum
bildet das Herz der Wohnung, die im übrigen aus kleinen Schlaf- und
Nebenräumen besteht. (Abbildung
1) Aufgrund dieses
Wohnungstyps entwickelt
de Fries einen gänzlich neuen Baublock, den es in dieser Form bisher nicht
gegeben hatte: Vor dem Ersten Weltkrieg war die malerische Wirkung der
Anlage noch das vorherrschende Motiv bei der Blockgestaltung, darüber hinaus
gehende Überlegungen zur Neuordnung des Gefüges von Wohnung und Stadt waren
eher die Ausnahme. Der Baublock, den de Fries nun aufgrund rationaler
Überlegungen entwickelt, kündigt einen Neubeginn an; er besitzt bereits
viele der funktionalen Qualitäten, die später auch Le Corbusiers spätere
Entwürfe bestimmen, etwa Müllschlucker und Kohlenaufzug. (Abbildung 2) De
Fries befürwortet übrigens auch die Anlage von Dachgärten, aber da ist für
de Fries nichts Revolutionäres dabei:
„Dachgärtenanlagen sind nichts Neues. Viel
besprochen und wenig angewandt wurden sie schon vor dem Kriege.“
– dieses Zitat nur als weiteres Indiz dafür, wie kontinuierlich sich die
Diskussion entwickelt.
Ich kann hier die ausgesprochen bemerkenswerte Schrift von de Fries nicht
eingehender behandeln und gebe nur noch ein Zitat aus seinem letzten
Abschnitt „Zur künstlerischen Gestaltung der Großstadt“. De Fries spricht
hier vom Städtebau in einer Weise, die Le Corbusiers bald darauf formulierte
Stadtvision bereits erahnen lässt:
„Das allmähliche Durchdringen der
Typenbildung auch im Mietetagenbau der Großstadt, das ja auch das
Doppelstockhaus zum Ziele hat, wird in zunehmender Weise dahinführen, Blöcke
und Straßen als große künstlerische Einheiten zu behandeln, durch Rhythmus,
Linienführung und Modellierung eindrucksvolle stadtbauliche Wirkungen
anzustreben.“
De Fries selbst ist es nicht gelungen, die von ihm prophezeiten
eindrucksvollen städtebaulichen Wirkungen in Form zu übersetzen; dazu
bedurfte es eines Genies wie Le Corbusier, doch dazu komme ich gleich. Aber
als Wegbereiter dürfen wir de Fries nicht vergessen, insbesondere weil für
ihn die „Raumwerte“
der Kleinwohnung entscheidend sind. Das muss man ihm zugute
halten, denn solches Denken in Räumen blieb die Ausnahme: Die
Grundrissplaner setzten sich durch. In dem Maße, indem die Architekten
Anspruch darauf erheben, die Frage wissenschaftlich zu lösen, werden
Grundrissfragen zum zentralen Problem: nicht mehr dem Wohnraum, sondern
der Wohnfläche gilt die Aufmerksamkeit. Je mehr es um
Kleinwohnungsgrundrisse ging, desto weniger Beachtung fand die Raumhöhe. Sie
wurde als unwesentlich ausgeschaltet. Gustav Wolf schreibt dazu in seiner
Studie Die Grundriss-Staffel. Beitrag zu einer
Grundrißwissenschaft von 1931:
„Den Raum begreifen wir zwar
vollständig nur durch ein gleichzeitiges Erfassen und Ermessen seiner drei
Ausdehnungen, der Länge, Breite und Höhe. Gerade den gebauten Wohnraum
empfinden wir in seinem Teil-Wesen gegenüber der Gesamtheit des Weltraumes
dadurch, dass ihn aus dessen Unendlichkeit die Begrenzung aller drei
Ausdehnungen abteilt. Aber als Erdenwesen dem Boden verhaftet, tasten wir im
Schreiten nur Länge und Breite körperlich ab, während wir die Höhe nur
gefühlsmäßig erfassen. Hiermit hängt es zusammen, dass bei der
raumwirtschaftlichen Betrachtung der Wohnung die Höhe in gewissem Sinne eine
Vernachlässigung erfahren darf, während Länge und Breite ununterbrochene
Beachtung verlangen und erhalten. Um es noch einfacher zu sagen: wer mit
seinem Hab und Gut einen Raum bewohnt, wird es sehr scharf empfinden, ob er
eine Länge von 5 oder 6 Meter, eine Breite von 3 oder 4 Meter
bewirtschaftet; weit weniger wird es ihn aber beschäftigen, ob die Höhe des
Raumes 3 oder 4 Meter beträgt. Diese Höhenentwicklung beeinflußt seine
Atmung, seinen Aufwand für Heizung, aber nicht so sehr sein „Ergehen“ im
engeren Wortsinne und die Unterkunft seines Hausrates.
Insofern genügt es also, wenn bei einem Versuch wissenschaftlicher
Behandlung der Raumwirtschaft zunächst einmal das Maß der Höhe einfach als
>ausreichend< vorausgesetzt und aus der Erörterung ausgeschaltet wird, wie
es im folgenden – mit den notwendigsten Ausnahmen von der Regel –
geschieht.“
Jetzt sind wir beim Grundriss, der
wissenschaftlich geklärt werden soll. Aber Wolf geht ja auch tatsächlich von
recht üppigen Raumhöhen aus: 3 bis 4 Meter. Nun waren die
Geschosshöhen wirklich nicht das Problem, denn die gesetzlich vorgegebenen
Mindesthöhen waren lange Zeit noch sehr hoch und betrugen selten weniger als
2,70 m. Vielleicht gibt es deshalb kaum Aussagen zu Raumproportionen: Die
Bauvorschriften sahen ohnehin damals noch recht ordentliche Mindesthöhen
vor, so dass bei den Kleinwohnungen tatsächlich über Höhen nicht mehr
nachgedacht wurde. Die Architekten gaben das Heft aus der Hand und
überließen es de facto den Bauordnungen, die dritte Dimension der Wohnung zu
regeln.
Jedenfalls war eine raumästhetische Argumentation, wie sie von Muthesius
vorgetragen wurde, kaum mehr zeitgemäß und konnte allenfalls als eine etwas
elitäre Liebhaberei gelten, als Relikt der Vorkriegszeit. Die großen Räume
der Mietskasernen sahen manche – angesichts von Überbelegung und
Schlafgängerwesen – gar als Feindbild. So erklärt Bruno Taut,
„dass auf dem Gebiet des Wohnungsbaues […] im
Suchen nach dem besseren Wohnungsgrundriß die Aufgabe des wirklichen
Architekten liegt.“
(meine Hervorhebung) Und er erklärt in einer Fußnote:
„[…] doch liegt […] oft genug der
schlechte Grundriß im Interesse von Unternehmern, weshalb z. B. auch gerade
aus ihren Kreisen heraus die Unzufriedenheit des harmlosen Publikums gegen
kleine Räume geschürt wird. Denn natürlich kostet ein Schlafzimmer von 22
Quadratmetern weniger im Bau als zwei kleine von je 11 Quadratmetern. Im
ersten Fall schlafen vielleicht 4 bis 5 Personen zusammen, in dem anderen je
2 und 2 bis 3 getrennt. Der Unternehmer dieser Art aber sagt: ich baue euch
„schöne“ große Räume und dazu billiger.“
Soweit Bruno Taut. Man kann an dieser Stelle erst einmal festhalten, dass
die Diskussion um die „Wohnung für das Existenzminimum“ die Frage der
Raumproportion des städtischen Interieurs zumindest vernachlässigbar
gemacht hat, denn wer wollte angesichts winziger Wohnungsgrundflächen noch
von Raumproportionen sprechen, zumal die Bauordnungen ja damals
– wie gesagt
– immer noch
Mindestraumhöhen vorsahen, die für die Zimmer der Kleinwohnungen allemal
ausreichend waren. Diese Maße waren gegeben; daran konnte nicht viel
geändert werden. Aber wie die Stadt, die zu dieser Wohnung passt, aussehen
kann, das war nun die Frage. Und so wendet sich der Blick dann vom
Wohnungsgrundriss, der ja bereits vor dem Ersten Weltkrieg ausgiebig
untersucht wurde, danach zum Grundriss der Stadt. Jetzt geht es sozusagen um
die Proportionen des Außenraumes. Es ist klar, dass sich das gesamte
proportionale Gefüge der Stadt ändern muss; die Neuordnung des Wohnraumes
und die Neuordnung des Stadtraumes müssen Hand in Hand gehen. Aus der Not
eine Tugend zu machen, bedeutete in diesem Fall: Wenn sich der Wohnraum
verkleinert, muss sich eben das gesamte Stadtgefüge dahingehend ändern, dass
wieder eine ausgewogenes Verhältnis von innerer und äußerer Räumlichkeit
entsteht.
Der Architekt, der zu dieser Frage am vernehmlichsten die Stimme erhob, war
Le Corbusier. Er fordert in Vers une Architecture eine
„Gesamtrevision aller üblichen Mittel“,
und einer seiner Leitsätze in Vers une Architecture lautet:
„Das moderne Leben verlangt, ja fordert für das Haus und die Stadt einen
neuen Grundriß.“
Le Corbusier hat die Stadt aber darüber hinaus auch als dreidimensionales
Stadtgefüge betrachtet.
Für ihn war es keine Frage, dass die Neuordnung der Stadt eine
grundsätzliche Neuordnung des proportionalen Raumgefüges und letztlich eine
neue Maßstäblichkeit dieses Gefüges bedeuten würde. Le Corbusier schreibt im
ersten Band des Oeuvre complète über den Pavillon de l’Esprit Nouveau
von 1925:
„Wenn man sich mit einem Problem
beschäftigt, trägt man es mit sich herum. Und eines schönen Tages kommt die
Lösung: manchmal findet man auf der Straße ihre Bestätigung. So bestätigt
jenes Gerüst, das an der Außenseite der “Magasins du Bon Marché„ aufgestellt
war, in seinen Maßen die These, daß man den Häusern unserer Städte einen
neuen Maßstab geben müsse. Es scheint, da die Häuser immer mehr von den
Straßen abrücken müssen und die Entfernungen zwischen ihnen immer größer
werden, dass die Höhe der Häuser verdoppelt und verdreifacht werden muß.
Unter diesen Bedingungen muß auch die Geschoßhöhe, die bisher 3–4 Meter für
gewöhnliche Wohnungen betrug, größer werden (Modul). Die Bedingungen des
Grundrisses, des Schnittes, werden neue Bedingungen in der Außenarchitektur
erzeugen. Der Modul einer neuen Zeit wird vielleicht 6–7 Meter betragen.“
Le Corbusier geht hier vom Stadtgrundriss aus, folgert, dass die Häuser
einen anderen Maßstab haben müssen, und kommt zu dem Schluss, dass sich
damit auch das Modul der einzelnen Wohnung ändern muss. Die Reihenfolge
scheint mir nicht entscheidend, wichtiger ist am Ende die Synthese, denn
andererseits erlaubt ihm dieses neue Stadtgefüge, eine Vorstellung zu
verwirklichen, die er schon weit früher entwickelt hatte. In dieses neue
Wohnungs-Modul von 6 bis 7 Meter bringt Le Corbusier dann zwei Etagen unter
– was einer persönlichen Vorliebe für niedrige Räume entspricht, über die
er sich bereits früher klar geworden war. Er schreibt später im
Modulor:
„Auf seinen Reisen hatte er [Le Corbusier spricht hier von sich in der
dritten Person] in harmonischen Bauten, mochten sie volkstümlich oder von
hohem geistigen Niveau sein, die Beständigkeit einer Höhe von ungefähr 2,10
bis 2,20 m (7 bis 8 Fuß) zwischen Fußboden und Decke festgestellt: in
Häusern des Balkans, türkischen, griechischen, Tiroler, bayrischen,
schweizerischen
Häusern, in alten Holzhäusern der französischen Gotik, und auch in den
>kleinen Appartements< des Faubourg Saint-Germain, sogar des Petit Trianon
[…]; dazu kam die Tradition der Pariser Läden, von Ludwig XV. bis zur
Restauration, mit ihrem Zwischenboden, der jene Höhe von 2,20 verdoppelte.
Es ist die Höhe eines Mannes mit erhobenem Arm (B), eine Höhe recht
eigentlich im menschlichen Maßstab.
Er konnte sich nicht versagen, diese schmackhafte Höhe in seine Bauten
einzuführen, um sich allerdings damit in Widerspruch zu den Bauvorschriften
zu bringen. Eines Tages erklärte ihm ein Baubeamter einer bedeutenden
Pariser Gemeinde: >Wir ermächtigen Sie, die Bausatzung gelegentlich nicht
einzuhalten, denn wir wissen, dass Sie für das menschliche Wohl arbeiten.<“
Dass Le Corbusier sich entgegen der Bauvorschriften für diese
Raumproportionen einsetzt, unterstreicht, dass ihm in erster Linie an einer
bewussten Neubestimmung des räumlichen Gefüges gelegen war. Wirtschaftliche
Erwägungen spielen dabei zwar eine wichtige Rolle, sie sind aber nicht das
bestimmende Argument. Die neue Höhe dieser Räume war Teil einer umfassenden
Vision von einer neu geordneten Stadt: Die Weite der Stadtlandschaft wird
erst durch die Enge der Wohnkabine erfahrbar. Und wenn man durch die Stadt –
oder was davon noch übrig bleibt – wandert, dann soll man die Häuser gar
nicht sehen, denn sie verschwinden hinter den Bäumen, die in dieser
Gartenstadt des Maschinenzeitalters mit ihren großen Wohneinheiten das
menschliche Maß bewahren sollen. Dazu Le Corbusier:
„All dies kann nur Funktion eines
Menschen sein, dessen Größe zwischen 1,50 m und 1,90 m schwankt. Dieser
Mensch allein würde vor der Weite der Erstreckungen zusammenschrumpfen. Es
gilt die Stadtlandschaft wieder zusammenzudrängen und Elemente im Maß
unserer Größe zu erfinden. Das Problem ist nichts anderes als ein
Architekturproblem; die Architektur arbeitet mit dem Wirkungsmittel des
Gegensatzes; man gestaltet eine Symphonie aus einfachen und vielfältigen,
aus kleinen und großen, aus zierlichen und wuchtigen Elementen. Die
ungeheuren Konstruktionen des künftigen Städtebaus würden uns erdrücken; es
bedarf eines vermittelnden Maßes zwischen uns und diesen Riesenwerken. Ich
habe bereits festgestellt, dass der Baum dies Etwas ist, das uns allen
zusagt, weil wir doch immer noch Gebilde der Natur bleiben […]. Der Baum
schließt das manchmal zu weite Blickfeld; sein freigebildeter Umriß tritt in
Gegensatz zu dem, was unsere Hirne erdacht und unsere Maschinen ausgeführt
haben. Der Baum scheint wie geschaffen zu diesem für unseren Komfort
wesentlichen Element, das in die Stadt etwas wie eine Zärtlichkeit
hineinträgt, etwas verbindlich Zuvorkommendes mitten zwischen unsere
rechthaberischen Werke.“
Bei diesen drei
Zitaten will ich es bewenden lassen. Sicher wäre zu Le Corbusiers Ideen noch
vieles anzumerken, ich hoffe aber, dass auch aus diesen drei Zitaten
hervorgeht, worauf es ihm ankommt: Auf die Zelle im menschlichen Maßstab,
die Häuser als große Wohnmaschinen und die Bäume, die daraus eine
Stadtlandschaft werden lassen – und last but not least kommt es ihm
darauf an, dass all das in einem Verhältnis zueinander steht.
Diese moderne Vision der Stadtlandschaft ist, wie die von mir
angeführten Vorbilder von Muthesius bis de Fries hoffentlich vorläufig zur
Genüge belegen, als Synthese früherer Bemühungen zu verstehen und weniger
als Gegenentwurf. Die Parallelen zu den Raumvorstellungen von Muthesius sind
unverkennbar. Auch für Le Corbusier erfordert die Auflösung der Stadt in der
Landschaft eine neue Art der Räumlichkeit auch für die einzelne Wohnung.
(Allerdings bleibt seine Vision des Wohnens im Grünen ein leeres
Versprechen: Von der Wohnung aus kann man die (Stadt-) Landschaft nur
ansehen, aber man kann nicht heraustreten in die Natur; man kann sich darin
nicht bewegen, ganz anders als bei Muthesius.) Man kann die Stadt der
Moderne – wenn man so sagen darf – auch als Bauen auf dem Lande verstehen.
Dann ist sie auch aus der Sicht früherer Stadtvorstellungen heraus
verständlich. Es lässt sich vermutlich nicht genauer nachweisen, in welchem
Maße Le Corbusier sich an Muthesius anlehnt, er hat aber Das englische
Haus gelesen und exzerpiert, wenn auch nicht die Stellen über die
Proportionen der Räume – aber dafür Muthesius’ Gedanken zum Verhältnis von
Haus und Garten.
Man kann in jedem Fall sagen, dass sein Entwurf mit diesen Theorien
übereinstimmt, vieles davon aufgreift und nicht im Widerspruch steht,
sondern sich transformatorisch daraus entwickelt.
Wenn Le Corbusier sich nun daran macht, das
Landhaus als „immeuble villa“ neu zu erfinden, steht er damit in einer
Kontinuität der Diskussion. Le Corbusiers Beitrag besteht nicht im
Aufstellen neuer Forderungen – er verwirklicht alte Forderungen. In der
Theorie ist fast alles da, als Le Corbusier und die anderen nach dem Ersten
Weltkrieg die Bühne betreten: was fehlt, ist die Form. Man sehe sich
nur Heinrich de Fries’ Entwürfe für Maisonette-Wohnungen an, um zu ermessen,
wie sehr sich Le Corbusiers eigentliche Leistung im engen Korridor der Form bewegt.
De Fries bietet eine merkwürdige Mischung von Neo-Biedermeier, deutscher
Neo-Renaissance, Ausklängen des Jugendstil und expressionistischen
Elementen. Und was bietet Le Corbusier Neues? Neu ist die Maschinenästhetik,
die diesem Programm den angemessenen Ausdruck verleiht.
Was
anderes ist denn die immeuble villa als der Versuch, ausgehend von
den unabweisbaren Forderungen nach Wohnökonomie, ein neues proportionales
Gefüge der Stadt zu verwirklichen – ein Gefüge, das dieser Realität Rechnung
trägt und deshalb die Verhältnisse von Interieur und Außenraum neu bestimmt?
Die Auflösung des Unterschiedes von Stadt und Land, die Stadtlandschaft, war
ja eigentlich der einzige Weg, aus der Wohnungsfrage heraus eine
Stadtgestalt, eine neue konzeptionelle Ganzheit zu schaffen, die eine
harmonische Struktur aufweist.
Ich breche meine zugegebenermaßen fragmentarische Beweisführung hier ab
und komme zum Schluss. Ich möchte eigentlich nur noch einmal nachdrücklich
darauf hinweisen, dass die Kritik an dieser Stadtvision, wie sie in den
1960er Jahren laut wurde, meiner Meinung nach zu einseitig ist. Die Kritik
an der Stadt der Moderne ging mehr oder weniger ausschließlich vom
städtischen Raum aus:
Jane Jacobs hat 1961 auf die Bedeutung des Straßenraums hingewiesen und die
Probleme öffentlicher Grünflächen analysiert. Colin Rowe und Fred Koetter
haben in den 70er Jahren die „Krise des Objektes“ diagnostiziert und sich
für den Baukörper als „space definer“ eingesetzt. Und Rob Krier hat 1975 in
seinem Buch Stadtraum versucht, eine praktische Ästhetik dazu
vorzulegen. Das sind nur drei herausragende Beispiele, weitere ließen sich
zuhauf anführen.
Aber diese Kritik an der Raumbildung ignoriert,
dass die Stadt ein Gefüge von öffentlichen und privaten Räumen ist.
Die Kritik hat die Stadtvision der Moderne allzu häufig nicht als Versuch
verstanden, einen neuen Stadtorganismus zu schaffen; sie hat sich nur für
den öffentlichen Raum interessiert. Dabei ging es ja nicht um eine Umkehrung
von Baumasse und Leere, sondern um eine Umwertung des proportionalen Gefüges
der Stadt. Ausgangspunkt war ja nicht der Baukörper, sondern die Wohnung.
Die Kritik an der Stadt der Moderne hat sich also meines Erachtens zu
eingeschränkt auf den Aspekt des öffentlichen Raumes fixiert.
So wurde der Verlust fassbarer städtischer Räume beklagt, aber so gut wie
nie wurde die Frage nach den Prinzipien städtischer Raumbildung auch auf das
Interieur ausgedehnt. Die Kritik hat die proportionalen Bezüge von
öffentlichem und privatem Raum nicht berücksichtigt.
Es ging der ›heroischen Moderne‹, ausgehend vom
Grundriss der Minimalwohnung, an der ja wohl kein Weg vorbei führte, um eine
durchgreifende Revision des gesamten proportionalen Gefüges. Für beides –
die Räume der Wohnung wie der Stadt – gab es natürlich auch ganz handfeste
wirtschaftliche und hygienische Anforderungen, aber die neue Form der Stadt
war eben doch eine Synthese, die sich aus der Erfüllung dieser Vorgaben
schwerlich erklären lässt: die Wohnung, der Verkehr, die Bautechnik, bis hin
zum Ornament – all das spielt mit hinein. Aber offenbar ist in
Vergessenheit geraten, dass es eben nicht nur der Stadtraum war, den man neu
ordnete, und so haben wir geglaubt, es genüge, wieder erkennbare Plätze und
Straßen zu bauen. Aber das genügt nicht.
Wir haben etwas vergessen, was den Architekten der Moderne durchaus
bewusst war: dass es eigentlich so etwas gibt wie Bauen auf dem Land und
Bauen in der Stadt bzw. dass Wohnweise und Stadtstruktur in einem
angemessenen Verhältnis stehen sollen. Dafür fehlt uns heute offenbar das
Gespür. Man muss der Moderne zugute halten, dass sie diesen Zusammenhang
gesehen hat; sie war weiter als wir es heute sind.
Wir sind ins 19. Jahrhundert zurückgefallen, und das auch noch auf
niedrigerem Niveau. Wir haben die Wohnung für das Existenzminimum –
auch heute noch –, aber von der dazugehörigen Stadtlandschaft haben wir uns
längst verabschiedet. Eigentlich hätten wir mit der Kritik am Stadtraum der
Moderne auch die Frage nach der Proportionalität von Innenraum und Außenraum
neu stellen müssen. Die Moderne hat ja – wie gesagt – beides neu geordnet:
die Wohnung und die Stadt (beides durchaus in Übereinstimmung mit vorher
vertretenen Positionen). Das vergisst man leicht, und so haben wir nur den
Stadtraum kritisiert und damit völlig missachtet und verkannt, dass die
Stadt ein proportionales Gefüge von öffentlichen Außenräumen und privaten
Innenräumen ist.
Ich glaube, dass die neueren Forschungen zu
den Räumen der Stadt die Chance bieten, die Stadt als ein räumliches Gefüge
zu sehen. Das zu tun, wäre mein Appell an die Forscher, die sich mit der
Stadt und ihren Räumen beschäftigen und die heute hier zusammengekommen
sind. – Ich danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit.
Abbildungen:
Abbildung 1 und 2:
Doppelseite aus: de Fries, Heinrich: Wohnstädte der Zukunft.
Neugestaltung der Kleinwohnungen im Hochbau der Großstadt, Berlin:
Verlag der „Bauwelt“, 1919
Literaturverzeichnis:
Benjamin, Walter: Gesammelte Schriften, Bd V · 1, Das
Passagen-Werk, hg. v. Rolf Tiedemann, Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag,
1982
de
Fries, Heinrich: Wohnstädte der Zukunft. Neugestaltung der Kleinwohnungen
im Hochbau der Großstadt, Berlin: Verlag der „Bauwelt“, 1919
Eberstadt, Rudolf: Handbuch des Wohnungswesens und der Wohnungsfrage,
Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1909
Gessner, Albert:
Das deutsche Miethaus. Ein Beitrag zur Städtekultur der Gegenwart,
München: F. Bruckmann A.-G., 1909
Klein, Alexander: „Beiträge zur Wohnfrage [im
Inhaltsverzeichnis: Wohnungsfrage]“, in: Probleme des Bauens. Der
Wohnbau. In Zusammenarbeit mit dem Studienausschuß des BDA für
zeitgemäßes Bauen herausgegeben von Fritz Block, Potsdam: Müller &
Kiepenheuer, 1928, 116–145
Le Corbusier: 1922 – Ausblick auf eine
Architektur, 4. Aufl., Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg, 1982 (=
Bauwelt Fundamente, 2)
Le Corbusier: „Pavillion
de l’Esprit Nouveau“, in: Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre
complète 1910–1929 (Bd. 1), hg. v. W. Boesiger und O. Stonorov, 9.
Aufl., Zürich: Les Editions d’Architecture, 1967
Le Corbusier: Städtebau, übersetzt und herausgegeben von Hans
Hildebrandt, 2. Aufl. (Faksimile-Wiedergabe der 1. Auflage 1929), Stuttgart:
Deutsche Verlags-Anstalt, 1979
Le Corbusier: Der Modulor. Darstellung
eines in Architektur und Technik allgemein anwendbaren harmonischen Maßes im
menschlichen Maßstab (1948), 5. Aufl., Stuttgart: Deutsche
Verlags-Anstalt, 1985
Maertens, Hermann: Der Optische-Maassstab
oder die Theorie und Praxis des ästhetischen Sehens in den bildenden
Künsten. Auf Grund der Lehre der physiologischen Optik für Architekten,
Maler Bildhauer etc., Bonn: Verlag von Max Cohen & Sohn (Fr. Cohen),
1877
Muthesius, Hermann: „Über häusliche Baukunst“, in: ders.: Kultur und
Kunst. Gesammelte Aufsätze über künstlerische Fragen der Gegenwart,
Jena/Leipzig: Eugen Diederichs, 1904 [nach
Kraus Reprint, dort kein Ort und Verlag angegeben]
Muthesius, Hermann: Das englische Haus.
Entwicklung, Bedingungen, Anlage, Aufbau, Einrichtungen und Innenraum.
2. durchgesehne Aufl., Berlin: Wasmuth, 1908-1911, 3 Bde, Bd. 2:
Bedingungen, Anlage, gärtnerische Umgebung, Aufbau und gesundheitliche
Einrichtungen des englischen Hauses, (1910)
Schnoor, Christoph: La Construction des
Villes. Charles-Edouard Jeannerets erstes städtebauliches Traktat von
1910/11, Diss. TU Berlin 2003
Taut, Bruno: Bauen. Der neue Wohnbau, herausgegeben von der
Architekten-Vereinigung „Der Ring“, Leipzig/Berlin: Verlag Klinkhardt &
Biermann, 1927
Oswalt,
Philipp; Warhaftig, Myra: „›Wohltemperierte Architektur‹. Gebäudeklimatische
Studien von Alexander Klein“, in: Wohltemperierte Architektur. Neue
Techniken des energiesparenden Bauens, hg. v. Philipp Oswalt (unter
Mitarbeit von Susanne Rexroth), Heidelberg: Müller, 1994
Weißbach, Karl: Handbuch der Architektur, Bd. IV. 2. 1:
Wohnhäuser, Stuttgart: Arnold Bergsträsser Verlagsbuchhandlung (A.
Kröner), 1902
Wolf, Gustav: Die Grundriss-Staffel. Beitrag zu einer
Grundrißwissenschaft. Eine Sammlung von Kleinwohnungs-Grundrissen der
Nachkriegszeit mit einem Vorschlag folgerichtiger Ordnung und
Kurz-Bezeichnung, München: Verlag Georg D. W. Callwey, 1931
Anmerkungen
Ein interessantes Beispiel für diesen Prozess ist das Werk von Alexander
Klein, der mit seinen Forschungen später auch für Architekten wie Bruno
Taut wichtig wird. Kleins Suche nach dem optimalen Grundriss der
Kleinstwohnung hat einen großbürgerlichen, um nicht zu sagen fürstlichen
Ursprung: Klein entwickelt seine Ideen an einem regelrechten Wohnpalast
in St. Petersburg. Das Miethaus am Kronwerk-Prospekt 5, das Alexander
Klein 1913 ausgeführt hat, ist bereits nach den Kriterien geplant, die
später auf die Kleinwohnungsfrage Anwendung finden (Vgl.:
Klein 1928; Abbildungen des
Petersburger Baus in: Wasmuths Monatshefte für Baukunst, 1926).
Erst unter dem Druck der Zeit widmet sich Klein der Minimalwohnung. Es
gibt eine Kontinuität: 1913 wird die großbürgerliche Wohnung optimiert,
damit sich die Wege des Personals nicht mit denen der Wohnungseigentümer
überschneiden, oder damit der Hausherr nicht durch Küchenlärm etc.
gestört wird: das Programm wird dann später auf die Wohnung für das
Existenzminimum übertragen.
Bei Alexander Klein spielen Raumproportionen noch keine
besondere Rolle, ihm geht es um den Grundriss, die dritte Dimension ist
kein Thema: Sowohl Körperformen als auch Raumproportionen sind im
Wesentlichen durch den klassizistischen Formkanon festgelegt. In seinem
späteren Werk bestimmen die klimatischen Bedingungen die
Raumverhältnisse; der städtische Kontext hat keinen Einfluss. Vgl.
Oswalt,
Warhaftig 1994.
Muthesius 1904, S. 87–89.
Ebd., S. 166f., Marginalie: „Niedrigkeit der Zimmer“.
Le Corbusier 1967, S. 105 (deutsche Fassung). Die Hervorhebung ist von
Le Corbusier.
Le Corbusier 1979, S. 197.
|