| Zum
Interpretieren von Architektur Konkrete Interpretationen 13. Jg., Heft 1, Mai 2009 |
|||
| ___Jan
Pieper Aachen |
Kritische Annäherung an die Peripherie der Architektur * |
| Wo
die Mercedes-Benz-Welt zuhause ist |
||
 Abbildung 1 Bildtext  Abbildung 2 Bildtext  Abbildung 3 Bildtext 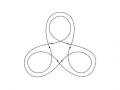 Abbildung 4 Bildtext  Abbildung 5 Bildtext  Abbildung 6 Bildtext  Abbildung 7 Bildtext  Abbildung 8 Bildtext  Abbildung 9 Bildtext  Abbildung 10 Bildtext  Abbildung 11 Bildtext  Abbildung 12 Bildtext  Abbildung 13 Bildtext  Abbildung 14 Bildtext  Abbildung 15 Bildtext  Abbildung 16 Bildtext  Abbildung 17 Bildtext  Abbildung 18 Bildtext |
Stuttgart
gehört zu den deutschen Städten, die den Fluss, an dem sie liegen, konsequent
aus dem Stadtbild entfernt haben. Der eigentliche urbane Raum der Öffentlichkeit
und ihrer Institutionen wie auch des privaten städtischen Lebens wendet
sich von ihm ab. Die Stadt liegt auf dem Talgrund eines Kessels, der vom
Nesenbach durchflossen wird. Dort, wo er in den Neckar mündet, öffnet sich
das Tal zu einer weiten und ebenen Flussaue, die zu Zeiten der Württembergischen
Residenz als Exerzierfeld des königlichen Militärs genutzt wurde. Gegen
Ende des 19. Jahrhunderts entstanden längs der Bahnlinien, die die Niederungen
östlich umfahren, erste Industrieanlagen, 1886 siedelte sich hier die Daimler-Motoren-Fabrik
an. Daraus entwickelten sich die ausgedehnten Produktionsstätten von Mercedes-Benz,
die heute den gesamten südlichen Abschnitt bis Untertürkheim bedecken. Nördlich
davon liegen weitere Industriebetriebe, die bis nach Cannstadt reichen,
durchsetzt mit Stadien und Sporthallen, und auf den Restflächen des Cannstädter
Wasen hat sich ein riesiger Rummelplatz eingerichtet. Das Ganze ist durchschnitten
von autobahnartig ausgebauten Schnellstraßen, Bahntrassen und anderen Verkehrswegen,
den einzigen Strukturen, die so etwas wie übergeordnete Planung erkennen
lassen und die gegenseitige Rücksichtslosigkeit der Standortkonkurrenten
auf das Notdürftigste im Zaum halten. Man
hat Kiplings Verse über das Calcutta der Nabobs im Ohr: „As the fungus
sprouts chaotic from its bed, so it spread, chance directed ..., chance
erected.“ Mitten in diese Stuttgarter Peripherie hinein, die nur noch der Logik von Mobilität und Ver- und Entsorgung gehorcht und insofern alles verhöhnt, was die städtische Kultur an urbanem Raum, Öffentlichkeit und Vielfalt der Lebensformen hervorgebracht hat, platziert nun Mercedes-Benz die Architektur seiner öffentlichen Selbstdarstellung, die „Mercedes-Benz-Welt“. Sie besteht aus einem Museum, das die gesamte Geschichte des Automobilbaus von den ersten Anfängen bis heute ausschließlich an Modellen aus eigener Produktion vorführt, sowie aus dem „Mercedes-Benz-Center“, das als „Flagship Store“ die aktuelle Modellpalette mit rund 150 Personenwagen vorhält. Beide Teile sind durch eine unterirdische Passage mit Gastronomie, Shops und Präsentationsflächen miteinander verbunden. Das Mercedes-Benz-Museum ist der architektonisch dominante Teil der Anlage, und in seiner kostbaren Sammlung von 120 legendären Fahrzeugen birgt es das gesamte technische und kulturelle Gedächtnis der Marke, und das heißt nicht weniger als: der Kultur und Technik des Automobils überhaupt. Der Entwurf des Museums und der Außenanlagen stammt von Ben van Berkel und Caroline Bos vom Amsterdamer Büro UN (United Network) Studio, die 2002 den von Mercedes ein Jahr zuvor ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen haben. Ihre Architektur steht für eine aktuelle Design-Strömung, für die sich im Jargon der Architekturkritik die saloppe, aber durchaus treffende Bezeichnung „Blob“ eingebürgert hat. Englisch „blob“ bedeutet „Klecks“, „dicker Tropfen“ oder „formlose rundliche Masse“. Verständigung: Die Sprache der Architektur Dennoch beansprucht auch dieses Bauen mit den Formen des Zufalls Architektur zu sein, und dies bedeutet: Darstellung und Deutung des Inhalts über die bloße Behausung und konstruktive Bewältigung des Zwecks hinaus. Sie muss sich dann, wie jede Architektur gleich welcher Kultur oder Epoche, eines allgemeingültigen Referenzsystems bedienen, das wir die „Sprache der Architektur“ nennen. Diese zu erfinden ist nicht Sache des Architekten, sondern sie ist wie alle Medien der Kommunikation Teil unseres kulturellen Systems, das ein komplexes Gefüge aus anthropologischen Konstanten und historischen Weiterungen darstellt. Sache des Architekten ist es, aus dieser Eigenbegrifflichkeit der Architektur, die in den elementaren räumlichen Gesten über ihre eigene Syntax und in den kulturell kodifizierten Bildern unseres kollektiven Gedächtnisses über ein eigenes reiches Vokabular verfügt, eine narrative Struktur zu entwickeln, die die Bauaufgabe in angemessene Formen fasst, beispielsweise in erzählerischer, weitläufiger Umschreibung oder in poetischer Zuspitzung. Unabhängig von den mit den Stilen und Epochen ständig wechselnden und sich weiterentwickelnden Mitteln der Konstruktion und Organisation bleiben die Elementarien der Architektur immer gleich, da sie aus anthropologischen Konstanten in unserem Verhältnis zum Raum herrühren wie der Wahrnehmung von Licht und Dunkel, Ort und Weg, Enge und Weite, Oben und Unten usw. Darüber hinaus haben sich in unserer Kulturgeschichte architekturspezifische Themen und Topoi herausgebildet, die einen zwar außerordentlich reichen, aber dennoch begrenzten und nicht willkürlich zu erweiternden Vorrat von Bildern, Formeln und Gesten darstellen, die über die Epochen und Stile hinweg jede bedeutsame Architektur ordnen. Dieses System aus kulturell Gewordenem und anthropologisch Gegebenem ist die Grundlage für eine Verständigung in der Sprache der Architektur über die Jahrhunderte hinweg, und deshalb haben wir zu den monumentalen Zeugnissen der Vergangenheit noch immer ein ebenso unmittelbares Verhältnis wie die Generationen der Erbauer. Deshalb kann und muss ein Bau, der mehr sein will als bloße Funktion und Konstruktion, auch heute genau so beurteilt werden wie die großen Monumente der Baugeschichte: als Ergebnis prägender Kräfte der Zeit auf der einen Seite, andererseits aber eben auch als überzeitliche Thematisierung des immer Gleichen in der Architektur. Dies sind die Prämissen, die eine Beurteilung von Architektur über den subjektiven Eindruck hinaus überhaupt erst ermöglichen, denen auch der „Blob“ standhalten muss, wenn er denn als Architektur verstanden werden will und nicht als Event und Design, die anderen Gesetzen unterworfen sind. Daran war hier in gedrängter Form noch einmal zu erinnern, bevor nun die Architektur des Stuttgarter Mercedes-Benz-Museums von Ben van Berkel einer kritischen Wertung zu unterziehen ist. Annäherung an einen rätselhaften Tempel Der Baukörper des Automobilmuseums erhebt sich als rundliche, dreifach spiralig gewundene metallische Struktur über einem nierenförmigen Grundriss auf einer geschosshohen Plattform. Dieser Sockel ist leicht gewölbt, auf der Eingangsseite sind ihm Stufen vorgelagert, seitwärts verschleift er sich mit dem natürlichen Niveau, so dass man auch mit dem Auto hinauffahren kann. In die kuppige Betonfläche sind an einigen Stellen runde Ebenen eingesenkt, von denen eine als Amphitheater gestaltet ist, andere der Belichtung der im Sockel befindlichen Räume dienen oder die als baumbepflanzte Ruhezonen gedacht sind. Der erste Eindruck des Ensembles ist durchaus monumental, vor allem der beinahe 50 Meter hohe und nahezu 40 Meter tiefe Solitär des Automobilmuseums wirkt massig und schwer. Durch die umlaufenden Fensterbänder, die die Horizontale betonen, scheint er flach, wie hingehockt, dabei allerdings ganz instabil. Die durch das Glas sichtbaren V-Stützen der Fassade erinnern unter den schweren metallbekleideten Brüstungsbändern an abgeknickte Streichhölzer, und vor allem im Erdgeschoss, wo sie nach innen eingezogen sind, lasten die gewaltigen Massen auf bedenklich dünnen Beinchen. Man steht vor einem Koloss, dem sogar die tönernen Füße fehlen. Der Solitär ist vollkommen richtungslos, auch die Plattform präsentiert keine Haupt- oder Nebenansicht, dennoch nähert man sich dem Ensemble in der Regel von Norden aus der Richtung der S-Bahn oder der Mercedes-Straße. Im ersten Blick auf Plattform und Solitär glaubt man die Bauidee erfasst zu haben, nach der sich die verschiedenen Funktionen von Museum, Passage und Präsentationsflächen ordnen und zu einem strukturierten Ganzen zusammenfügen. Mit der aufgewölbten Betonplattform scheint sich ein befriedeter Bezirk aus der umliegenden Brache auszugrenzen, eine Art Temenos, über dem sich der schimmernde Solitär des Museums in spiraligen Windungen als Kultstätte des Automobils erhebt. Dies wäre in der Tat ein unmittelbar einleuchtendes Konzept, das sich der archetypischen Scheidung von Sakralem und Profanem für die architektonische Inszenierung des säkularisierten Kultes am Automobil bedient, wie er im Innern des Museums ja tatsächlich gepflegt wird. Zugleich wäre im Rückgriff auf diese Grundfigur der räumlichen Ordnung nicht nur ein angemessenes architektonisches Bild für die Bauaufgabe gefunden, sondern auch städtebaulich richtig auf das Durcheinander der urbanen Peripherie draußen reagiert. Mit den spiraligen Windungen des Solitärs scheint auch eine treffende architektonische Chiffre für das Mercedes-Sanktuarium gefunden, worin das Automobil in seiner technischen Rationalität, in der Dynamik seiner Bewegungen und in der Ästhetik seiner rasanten Formen gefeiert wird. Denn die Spirale ist die Abbreviatur des Babelturmes, Symbol menschlicher Ingeniosität und Hybris zugleich. In dieser kodifizierten Bedeutung wird der Turm zu Babel in den verschiedensten Epochen der Architekturgeschichte immer wieder aufs Neue beschworen, von Borrominis Sant’Ivo alla Sapienza bis zu Tatlins Spirale, schließlich auch in Frank Lloyd Wrights Guggenheim-Museum, dessen Windungen der Meister auf einem pastellfarbenen Ansichtsblatt ausdrücklich als „Zikkurat“ gekennzeichnet hat. Immer sind die Spiralen dieses Turmes der Ausdruck höchster Verehrung und Mahnung in einem. Doch diese Temenos- und Babelturmidee wird im Mercedes-Benz-Museum durch die Einzelheiten der Durchführung beiläufig zurückgenommen und schließlich in ihr Gegenteil verkehrt. Denn die Plattform ist an den Rändern so ausgebildet, dass sie kein befriedetes Inneres aus dem urbanen Chaos ringsum ausgrenzt, sie hat keine abweisend geschlossene Raumkante, wie dies die konsequente Durchführung der Idee erfordern würde, sondern sie präsentiert sich als eine flach aufgewölbte, allseitig offene Erhebung. So zieht sie die Unordnung der umliegenden Stadtbrache gewissermaßen zu sich herauf und überhöht sie fatalerweise noch in den willkürlichen Deformationen des Baukörpers. Aus einer Urform der architektonischen Ordnung im Raum, aus der sakralen Aufgipfelung der Stadt im Tempel, wird eine offenkundige Verherrlichung des zufälligen Durcheinanders aus Verkehrswegen, Stadien, Rummelplätzen und Industriestandorten ringsum. Das Mercedes-Benz-Museum, das den Triumph des Automobils feiern sollte und ihm dafür eine wirklich ernst gemeinte Kultstätte seiner Geschichte, Technik und Ästhetik zu errichten hätte, verkehrt sich durch die parodistische Subversion der Ausgangsidee im Detail in das genaue Gegenteil, in eine negative Ikone. Es lenkt die Assoziationen und Erwartungen des ankommenden Besuchers nicht zuerst auf die Schönheit des Automobils und nicht auf die Wunder seiner Technik, nicht auf die Welt aus Strömen und Strahlen, die aus der Dynamik seiner Bewegungskurven entsteht, sondern auf seine zerstörerischen Folgen für die Urbanität. Unfreiwillig oder vielleicht auch gewollt wird dieses Automobilmuseum so zu einem Mahnmal für die Auflösung des urbanen Raumes in den Restflächen der Peripherie, die mit dem Einbruch der Mobilität und der Geschwindigkeit in die statischen Strukturen von Stadt und Landschaft gegen Ende des 19. Jahrhunderts ihren Anfang nahm. Entwerfen ad libitum Wie der städtebaulichen Grundfigur, die mit dem Bild von Temenos und Turm erst angedeutet, dann in der Durchführung aber gleich wieder verworfen oder ins Negative gewendet wird, geht es auch allen anderen architektonischen Denkfiguren, die kurz am Horizont des Blob wie eine Fata Morgana auftauchen, bei genauem Hinsehen aber schon wieder zerplatzen. Zwar erzeugt diese Architektur pausenlos Bilder, Versatzstücke und Pathosformeln, dies aber in völlig beliebiger Zusammenstellung und in subjektiver Assoziation: Nichts ist einem übergreifenden ikonologischen Konzept zugeordnet, der eine Verweis konterkariert den nächsten, und so bleibt es beim endlosen Formelaufsagen, ohne dass auch nur ein einziger Gedanke zu Ende gebracht worden wäre. Schließlich begreift man, dass diese Architektur überhaupt nicht reflektiert genug ist, um erkennbar intentional mit Zitaten oder Verweisen aus dem klassischen Fundus zu operieren. Stattdessen ist sie nach dem MTV-Prinzip des schnellen Wechsels immer neuer Clips organisiert, das Ergebnis einer unsäglichen Verflachung, die schon in den vorübergehenden Belästigungen der Unterhaltungsindustrie auf die Nerven geht, in der Permanenz der Architektur aber ganz unerträglich wird. Die formale Sprache des Baukörpers ist in Design und Materialität der Automobiltechnik entlehnt. Gekrümmte Bleche umhüllen wie eine Karosserie die tragende Konstruktion, die Wellen und Kurven tun so, als seien sie im Windkanal aerodynamisch getestet, ihre Rundungen suggerieren Bewegung und Geschwindigkeit. Aus den Spiralen des Babelturmes wird so zugleich ein Riesenfahrzeug, das aber immobil daliegt wie die gestrandete Arche, im Bauch ein Exemplar von jeder Spezies der Marke Mercedes. Aber auch dabei bleibt es nicht, denn die Karosserie dieses Riesenvehikels ist an vielen Stellen willkürlich verformt und zerknautscht, die Blechteile gestaucht und die Glaswände wie im Crash zusammengeschoben, ein Eindruck, der durch die geknickten V-Stützen in den Fensterbändern noch verstärkt wird. Offensichtlich ist dies alles gewollt, obwohl solche Bilder im Kontext der architektonischen Selbstdarstellung eines Automobilkonzerns parodistisch wirken müssen. Als wenn dies alles nicht schon allzu viel zitiert, verwiesen und angedeutet wäre, wird noch einmal die Palette gewechselt, wenn man das Gebäude über seine gerundete Ecke betritt. Die geschosshohe Glasschürze der Fassade hängt hier nur bis zur halben Höhe der Stützen herab, so dass der Eingang einen maulartigen Eindruck macht. Die latent zoomorphen, manchmal auch organischen Assoziationen, die der Bau auch im Inneren in vielen Einzelheiten bereithält, werden hier auf den Baukörper insgesamt projiziert. Keine dieser Figuren wird mit der notwendigen Konsequenz so weit entwickelt, dass man von Leitmotiven, geschweige denn von einer Bauidee sprechen könnte, die die vielfältigen Funktionen, Inhalte und technischen Notwendigkeiten des Bauwerks zu einem Ganzen zu ordnen vermöchte. Schon bevor man ins Innere des Gebäudes gelangt, ist deutlich geworden, dass hier immer neue Geschichten erzählt werden, ohne dass auch nur ein einziger Höhepunkt erreicht würde. Der narrative Faden reißt schon nach der Disposition des Themas ab, immer neue werden begonnen und nicht zu Ende gebracht, Verknüpfungen und wechselseitige Steigerungen werden gar nicht erst versucht. Wenn man am Ende des Rundgangs durch das Gebäude wieder draußen auf der Plattform steht, ist der Kopf so leer, als hätte man sich einen ganzen Fernsehabend lang durch 32 verschiedene Kanäle gezappt. Zeitreise auf Kreuzwegen Wenn man das Gebäude betreten hat, ist man erst einmal wieder versöhnt, denn nun erwartet den Besucher eine absolut einmalige Sammlung. Mercedes hat seit Bestehen der Daimler-Motoren-Werke alle Stücke aus seiner Produktion gesammelt und aufbewahrt. Was fehlte oder abhanden gekommen war, wurde zurückgekauft, und so verfügt die Firma heute über eine lückenlose Dokumentation ihrer eigenen Geschichte. Für die älteste Automobilfabrik der Welt ist dies gleichbedeutend damit, dass die gesamte Geschichte des Automobilbaus hier in Originalen gezeigt werden kann. Die beiden ältesten Automobile überhaupt, das motorisierte Dreirad von Carl Benz von 1885 und die 1886 von Gottfried Daimler und Wilhelm Maybach mit einem schnell laufenden (250 Upm) Viertaktmotor ausgerüstete und umgebaute vierrädrige Kutsche sind hier zu sehen, sogar der erste kompakte Verbrennungsmotor, die sogenannte „Standuhr“, hat sich erhalten. Es gibt ein wunderbares Exemplar des Mercedes-Simplex 40 PS, mit dem die eigentliche Geschichte der Marke beginnt, und dann geht es immer weiter, vorbei an den schnittigen Karosserien der 50er und den behäbigen Limousinen der 60er Jahre, vorbei an den legendären Silberpfeilen des Rennsports bis hin zu den neuesten Entwicklungen, die vorerst nur in Modell und Animation existieren. Insgesamt bekommt man 120 Automobilexponate zu sehen, 80 PKW, 40 Rennwagen und 40 Nutzfahrzeuge. Das Ausstellungskonzept für diese Sammlung von Inkunabeln der Automobilkunst wurde von HG Merz entworfen. Er hat auch das Programm für das Museum aufgestellt und die wichtigsten Vorgaben für den Architektenwettbewerb getroffen, und somit kann man ihn als den spiritus rector des ganzen Unternehmens bezeichnen. Das Ausstellungskonzept ist von einer genialen Einfachheit. Der Besucher wird zwei Wege entlanggeführt, die sich ständig kreuzen, er wird auf eine „Zeitreise“ geschickt, die ihn von den Anfängen der Automobilgeschichte bis in die Gegenwart führt und am Ende in die Visionen der automobilen Zukunft entlässt. Merz hat diese chronologische Folge in sieben „Mythos“-Räume eingeteilt, die in den englischen Erläuterungen richtiger „Legenden“-Räume heißen, und die so im Entwicklungsgang der Automobilgeschichte die wichtigsten Erscheinungen einer Epoche deutlich hervortreten lassen. Der zweite Weg führt durch Themenräume, die in sogenannten „Collectionen“ Automobile für bestimmte Zwecke oder Zielgruppen vereinigen. So gibt es etwa eine „Galerie der Reisen“ mit Bussen, eine „Galerie der Helfer“ mit Einsatzfahrzeugen der Rettungskräfte, eine „Galerie der Lasten“ mit LKWs usw. bis hin zu einer „Galerie der Namen“, wo eine Reihe von Mercedes-Limousinen von Berühmtheiten aus Film und Politik zu sehen sind. Beide Wege werden von erläuternden Tafeln oder Ausstellungskästen begleitet, die einzelne Aspekte durch Accessoire-Exponate illustrieren oder in sogenannten „Werkbänken“ das technische Geschehen hinter dem Design erläutern und vertiefen. Am Ende beider Wege gelangt man in „Labors“, wo durch geschultes Personal Einblicke in die Arbeit der Ingenieure und Designer gegeben wird. Dies waren die programmatischen, aber räumlich und architektonisch noch völlig offenen Vorgaben für den Architektenwettbewerb, den Ben van Berkel und sein UN-Studio gewonnen haben. Sie haben das großartige Ausstellungskonzept in ein System aus Wegen und Räumen umgesetzt, das auf der Grundidee einer sich immer wieder durchdringenden dreidimensionalen Doppelhelix beruht. Die „Zeitreise“ ist als Spiralrampe angelegt, der Weg durch die „Collectionen“ der Themenräume als spiralige Treppe, und beide sind in der dritten Dimension so miteinander verschlungen, dass man jederzeit von einem Weg in den anderen wechseln kann. Beide Spiralfiguren sind einem dreieckigen Umriss mit gerundeten Ecken und gekurvten Seiten einbeschrieben, so dass das Gebäude im Grundriss an die Nierentischform der 50er Jahre erinnert. Im Aufriss jedoch sind die Glasbänder der Außenwände immer wieder bis an die sich ständig ändernden Radien der Spiralrampen herangeführt, was die schon beschriebene Kontorsions-Geometrie des Baukörpers erzeugt. Die Macht des Tragwerks Für die Statik und Konstruktion des Gebäudes zeichnet der Stuttgarter Bauingenieur Werner Sobek verantwortlich, der aber auch mit experimentellen Bauten als Architekt Aufmerksamkeit erregt hat und sich mit Ben van Berkel darin einig weiß, „dass wir in der Architektur völlig neue Formen brauchen“. Die Spiralen der Rampen sind zweischalig in Beton als Hohlkästen ausgeführt, die als kontinuierliches Band eines einzigen kolossalen Unterzuges durch das gesamte Gebäude geführt werden und neben dem Weg auch die Ebenen tragen. Sie ruhen außen auf den schräg in die Fassade gestellten Stützen, innen auf drei gewaltigen Vertikalkernen, in denen die Fluchtwege, die Versorgungsstränge und die Sanitär- und Nebenräume untergebracht sind. Dazwischen liegt, von den Spiralen ausgespart und deshalb im Grundriss wieder ein sphärisches Dreieck, ein „Atrium“ genannter Hohlraum, der das gesamte Gebäude an die fünfzig Meter hoch durchzieht. Im Auf- und Abstieg auf den Spiralen blickt man immer wieder in diesen gigantischen Schacht, und vor allem von der tief liegenden Eingangsebene aus ist der Eindruck überwältigend. Ohne Frage ist Ben van Berkel hier eine großartige Raumschöpfung gelungen, die allerdings zwischen Staunen und Schaudern hin- und herschwanken lässt. Höhenzug und Lichtwirkung der Kathedrale sind mit der monolithischen Gewalt präkolumbianischer Architektur eine widersprüchliche Verbindung eingegangen. Man ahnt, dass der Gott, der in diesem Tempel wohnt, einen nicht nur zu sich emporziehen, sondern auch unter sich zerquetschen kann. Von nun an geht’s bergab Unten in der Halle beginnt der Weg durch das Museum. Links im Hintergrund sieht man, wie sich die Spirale der Zeitreise mit der Wand verschleift, hier müsste der Aufstieg aus der Vergangenheit durch die Geschichte des Automobils in seine Zukunft beginnen. Aber es ist genau umgekehrt, denn was man dort im Hintergrund der Halle sieht, ist nicht der Anfang, sondern das Ende des Rundganges. Aus unerfindlichen Gründen lässt der Architekt den Besucher zuerst mit dem Aufzug nach oben fahren, wo unter dem Dach des Gebäudes der Weg beginnt: Die Zeitreise ist ein Abstieg. Dies ist ohne Frage ein schwerer konzeptioneller Fehler, der in eklatantem Widerspruch zum Ausstellungskonzept und gewiss auch zu den Intentionen des Auftraggebers steht, denn in der Architektur führt die positiv besetzte Bewegungsrichtung immer von unten nach oben. Sie folgt damit fest etablierten Wahrnehmungsmustern der Kulturgeschichte, die von Xenophons Anabasis-Katabasis-Schema über Petrarcas formelhafte Besteigung des Mont Ventoux bis zu den metaphorischen Bergvisionen der Romantiker immer nur den Aufstieg von Niederen zum Höheren feiert und den Abstieg bestenfalls als geläuterte Rückkehr schätzt, sonst aber nur als schicksalhaften Niedergang, als Weg in die Tragödie kennt. Darin ist nichts anderes zu sehen als der kulturelle Niederschlag anthropologischer Grunderfahrungen, etwa der Vertikalen als der Dominanzlinie der menschlichen Haltung oder des befreienden Erlebnisses im Aufstieg vom Dunklen zum Licht, von der Enge zur Weite, von der Höhle zum Himmel. Hier aber fährt man in einer geschlossenen Kapsel hinauf, statt eines klassischen Ascensus aus den bescheidenen Anfängen der Motorisierung im Halbdunkel der unteren Geschosse über die historischen Entwicklungen, schließlich in rasanten technologischen Sprüngen zu einer noch ungeahnten Zukunft des Automobils, die sich gleichnishaft im Öffnen der Evolvente unter der Lichtdecke andeuten könnte, geht es hier immer nur abwärts. Die Spirale der Zeitreise dreht sich nach unten bis hinab ins Souterrain, in den Trichter eines Mahlstroms. Wenn man hier keine parodistische Absicht unterstellen will, bleibt nur Ahnungslosigkeit oder Nonchalance im Umgang mit den elementaren Gesten der Architektur. Auf jeden Fall ist es einfach unbegreiflich, wie eine architektonische Inszenierung so offensichtlich dem Selbstverständnis und dem Programm des Auftraggebers zuwiderlaufen kann, wie ein Architekt die nur positiv gemeinte Dynamik der ganz auf Aufbruch, Fortschritt und Zukunftsgläubigkeit hin angelegten Zeitreise mit so eindeutigen architektonischen Formeln des Scheiterns und der Aussichtslosigkeit konterkarieren kann. Abgesehen von dem ikonologischen Desaster, das der Architekt seinem Auftraggeber hier zumutet – der, einige architektonische Kultur vorausgesetzt, dies allerdings auch selber beizeiten hätte bemerken müssen –, steht die gewählte Erschließung der Ausstellung auch im Widerspruch zur museumstechnischen Konzeption. Die Zeitreise ist als zeremonieller Weg angelegt, auf das kontinuierliche Durchschreiten einer chronologischen und thematischen Abfolge, die eine kontinuierliche Bewegung des Besucherstroms verlangt. Die Portionierung der Besucher in die 20-er Gruppen des Aufzugs stört diesen transitorischen Charakter des Museumsbesuches ganz empfindlich, gleichgültig, ob man den Weg durch die Ausstellung eher rituell, als einen prozessionsartigen Ablauf auffasst – wie es die auratische Überhöhung der Automobile auf den Patenen ihrer Sockel nahe legt – oder eher spielerisch, erlebnishaft im Sinne einer Promenade. Man fährt also in drei Aufzügen nach oben, die sich als geschlossene Kapseln außen an den Vertikalkernen frei im Hohlraum der Halle bewegen. Leider kann man aus den Aufzügen praktisch nicht hinausschauen, so dass man während der Fahrt das Volumen der Halle nicht erlebt. Oben angekommen wartet die nächste Enttäuschung. Die Aufzüge enden auf einer dreiarmigen Brücke, die man von unten schon als formale Variation des Mercedes-Sterns über der Halle sehen konnte. Aber oben von der Brücke gestattet der Architekt keinen Blick nach unten, der gewiss atemberaubend wäre, denn zwischen den Speichen des Dreisterns sind undurchsichtige Segel aufgespannt. Als Empfangsraum ist die Brücke vollkommen ungeeignet, obwohl sie diese Funktion, gewissermaßen als hoch liegendes Vestibül der Ausstellung, die eben hier beginnt, ja tatsächlich hat. Dem Raum fehlt dafür aber die notwendige Höhe, man klebt förmlich unter der Lichtdecke. Zudem ist mitten auf die Brücke ein zylindrischer Schacht mit der Entrauchungsanlage gesetzt, der den Blick verstellt. Schließlich leistet das Ambiente auch nicht die geringste Orientierungshilfe, wie dies notwendigerweise Aufgabe eines Vestibüls zu sein hat: Die drei Arme führen zu drei identischen Türen, man kommt in drei Aufzügen an den drei gleichen Enden der sternförmigen Brücke an, aber nur ein Arm und eine Tür führen in die Ausstellung. Die anderen werden wohl immer verschlossen sein, denn sie erschließen die nicht öffentlichen Restflächen des Blob, die als Cafeteria, Büro und Konferenzraum hergerichtet sind. Kommt, lasst uns anbeten Im ersten Raum beginnt der spiralförmige Weg hinab durch die Ausstellung, und im Anblick der Exponate und ihrer meisterhaften Inszenierung hat man sich vorübergehend damit arrangiert, dass alles falsch herum läuft, denn das, was man zu sehen bekommt, muss einfach begeistern. Dies gilt nicht nur für die wunderbaren Automobile, über die schon genug gesagt wurde, sondern auch für ihre meisterhafte architektonische Inszenierung. Die Ausstellungsarchitektur von HG Merz stellt jedes Objekt auf den ihm angemessenen Sockel, vor den ihm bestimmten Hintergrund und in die richtige Nachbarschaft. Sie unterstützt im Material und Design der Postamente die stilistischen Besonderheiten der einzelnen Automobile, eine raffinierte Lichtführung unterstreicht ihren besonderen technischen Charakter und die Dynamik ihrer Linienführung, die man sonst gewiss so nicht wahrnehmen würde. Kurzum, die gesamte Zeitreise durch alle Ebenen der Ausstellung hinab belegt immer wieder aufs Neue, wie durch kluges Design, das richtige Material, das genau dosierte und geleitete Licht die auratische Erhöhung der Automobile hundertfach variiert wird und jedes Mal überraschend neu gelingt. Zudem ist die architektonische Detaillierung der Ausstellungsmöbel, der Hintergründe, „Werkbänke“ und Schaukästen so perfekt, so präzis in den stilistischen Verweisen und kulturgeschichtlichen Zitaten, dass man schlicht konstatieren muss: Hier ist ein wirklicher Meister am Werk gewesen. Kampf der Konstruktion Umso irritierender ist es angesichts dieser Könnerschaft, wenn der Blick vorbei an der Architektur der Ausstellung auf die des Gebäudes fällt. Immer wieder sieht man Ungereimtheiten der Raumkomposition, ungelöste Anschlüsse, verkrampfte Details, die man allein der Werkplanung des Architekten anlasten muss, denn die handwerkliche Ausführung aller Gewerke ist durchweg von hoher Qualität. Verantwortlich für diese Kunstfehler ist ein hemmungsloser Formalismus, der im Inneren bis auf die Treppenkerne alle tragenden Teile sphärisch verdreht, sie an vielen Stellen auch die Fassade durchdringen lässt und außen die Brüstungen und Glasflächen der Fensterbänder ebenfalls willkürlich hin- und her-twistet. So schafft man sich zahllose handwerkliche, geometrische und bauphysikalische Probleme, die sich allein einer obsessiven Neigung verdanken, alles und jedes zu deformieren. Zwar haben sich die Architekten bei der Detailbewältigung ihrer eigenen Willkür meist wacker geschlagen, aber an vielen Stellen eben auch nicht, und ohnehin macht es wenig Sinn, durch immer neue Schrägen, Kurven und windschiefe Durchdringungen von innen und außen geometrische und bauphysikalische Probleme künstlich zu schaffen, um sie dann mehr oder weniger virtuos zu bewältigen, anstatt von vornherein in der Reduktion zu räumlicher, konstruktiver und gestalterischer Klarheit zu finden. Das Ergebnis ist eine Wiederbelebung des Fin-de-siecle-Zuckerbäckerstils mit zeitgenössischen Mitteln in Glas und Beton mit Metallverkleidungen, der die architektonischen Strukturen ebenso verklebt wie der Stuck des wilhelminischen Eklektizismus. Man sehnt sich am Ende wieder nach der Wahrheit der frühen Moderne, die wusste, dass weniger mehr ist. Skulpturale Falle Überhaupt fehlt dieser Architektur ein Gefühl für das rechte Maß. Das gilt für ihre großen Gesten ebenso wie für die Einzelheiten. Bei aller Bewunderung für die Ingenieurleistung der 33 m langen spiralig gewundenen und sphärisch verdrehten Beton-Hohlträger muss man nach dem architektonischen Sinn eines solchen Kraftakts fragen. Die Träger haben keineswegs die Eleganz eines Propellers, wie die Architekten behaupten, sondern sie sind ausgesprochen klobig, massig und bedrückend. Die Form des Propellers entwickelt sich aus der rational nachvollzogen aerodynamischen Funktionalität, hier jedoch ist die nicht mehr als eine vorgefasste, der Architektur aufgesetzte skulpturale Idee, die zudem das formale Vorbild unendlich vergrößert und dabei eine höchst ungute Massenwirkung erzeugt. Diese steht in eklatantem Widerspruch zur Formensprache der Spiralen, die Offenheit und Leichtigkeit suggerieren sollen, so aber alptraumhaft und in bedrohlicher Schwere den Betrachter bedrängen. Einige Architekturkritiker haben dies alles „piranesihaft“ genannt, ohne weiter über den Sinn solcher Konnotationen nachzudenken, denn in den „Carceri d’invenzione“ – in den „Gefängnissen der Erfindungskraft“ – wird sich Mercedes-Benz ja wohl kaum wiedererkennen wollen. Aber die Metapher führt auch sonst in die Irre, da Piranesi in seinen unbegrenzten Perspektiven aus klar umrissenen Vordergründen in immer tiefere Hintergründe eindringen lässt. Hier dagegen bleiben die Durchblicke, die sich unter den schwebenden und verdrehten Massen ergeben, eng begrenzt, sie führen nicht weiter in die Tiefe. Es öffnen sich hinter der ersten Raumschicht keine weiteren in hintereinander geschachtelten Fluchten, sondern der Blick führt in die Enge, vor die Wand oder durch die Fenster hinaus in die Banalität draußen. Piranesi zieht seine Betrachter in reale oder auch nur erahnte Räume hinein, lässt sie davor zurückschaudern oder erweckt mit in der Tiefe aufscheinenden Lichtblicken die Sehnsucht nach Ausbruch und Befreiung aus seinen Carceri. Von solcher Raumkunst aber ist das Stuttgarter Museum weit entfernt, denn bei aller Kompliziertheit der Formen ist es räumlich nicht komplex. Jede „scena all’ angolo“ aus den Lehrbüchern der Kulissenarchitektur des Barocktheaters ist da räumlich raffinierter. Für das Ausstellungskonzept bringt die konstruktive Idee des Ganzen und die daraus resultierende schiere Masse der sphärisch verdrehten Träger eine ganze Reihe von Nachteilen. In den Themenräumen bedrängen die sphärischen Untersichten der Decken die Exponate, dort wo Nutzfahrzeuge stehen, sind die Raumhöhen auch tatsächlich zu gering. Die Ausstellungsplattformen sind zu klein, einige regelrecht vollgestopft. Und vor allem ergeben sich aus der spiraligen Führung der Konstruktion enorme Zwänge für den Zuschnitt der Ausstellungsbereiche, die Formen, die freie Bewegung suggerieren sollen, engen die Nutzungsmöglichkeiten ein, es gibt keinerlei Spielraum für Veränderungen oder Erweiterungen. In den Themenbereichen sind nicht einmal Wechselausstellungen möglich, die einzelne Aspekte vertiefen könnten. Diese Architektur, von der ihr Urheber sagt, dass sie alle Einengungen konventioneller Museumstypologien hinter sich ließe, um ein freieres Erlebnis der Exponate zu ermöglichen, ist in Wirklichkeit eine Vergewaltigung von Zweck und Inhalt des Bautyps. Maß und Ziel Bis in die Einzelheiten lässt das Museum jedes Gefühl für die Angemessenheit von Form und Abmessung vermissen. Die Spiralrampen messen im Lichten 2,10 m, da rechts und links Besucher stehen werden, die die Erläuterungstafeln an den Wänden studieren oder von oben auf die Exponate auf den Ausstellungsebenen herabblicken, bleiben als Durchgangsbreite für den Besucherstrom gerade 90 cm. Selbst wenn niemand an den Seiten steht, können nur drei Personen auf der Rampe nebeneinander gehen. Das wird einfach nicht reichen. Im Guggenheim Museum von Frank Lloyd Wright, von dem die Idee der aufsteigenden Spiralrampe entlehnt und dann gründlich missverstanden wurde, beträgt die Rampenbreite immerhin 4,80 m. Auch die Treppen, die in Spiralführung die Themenbereiche miteinander verbinden, sind falsch dimensioniert. Das Steigungsverhältnis – beispielsweise im Bereich der „Galerie der Lasten“ – beträgt 19/25. Das ergibt zwar ein korrektes Schrittmaß von 63 cm, aber die Steigung ist für ein öffentliches Gebäude viel zu groß. Noch schwerer wiegt, dass sich das Steigungsverhältnis innerhalb ein und derselben Treppe mehrfach ändert, da der Lauf der wechselnden Neigung der schiefen Ebene folgt, bis schließlich ein Stufengang von 19/63 daraus wird. Hier ist das Schrittmaß ganz unbrauchbar, man tritt immer mit dem gleichen Fuß auf, so dass die Treppe weder angenehm noch sicher zu begehen ist. Neben den Rampen liegen gelegentlich Sitznischen, zu denen man einige Stufen von 178/34 herabsteigt. Auch hier ist die Schrittmaßregel nicht eingehalten, aber ganz inakzeptabel ist, dass sich die Stufen mit der Rampe verschleifen und sich damit als wahre Stolperfallen erweisen werden. Es ist unbegreiflich, dass ein Automobilkonzern, der bei den eigenen Produkten jedes Detail bis zur Perfektion entwickelt, in einem der wichtigsten Gebäude seiner Selbstdarstellung so lächerliche Fehler durchgehen lässt. Auch hier, so scheint es, hat man vor lauter selbstgefälliger Begeisterung über das „Einmalige“ und „Ungewöhnliche“, tatsächlich aber Exzentrische des Entwurfs keinen Blick mehr für das Detail gehabt. Oder sind auch diese Missachtungen der aus dem menschlichen Maß hergeleiteten Regeln des Handwerks der Architektur am Ende gar keine beiläufig passierten Fehler, sondern vorsätzliche Verstöße, so wie ja auch die Deformationen des architektonischen Bildungsgutes der Sprache, Gestik und Kultur des künstlerischen Bauens vorsätzlich herbeigeführt sind? Dann müsste man den Bau insgesamt als eine Attacke auf die Humanitas der Architektur in beiderlei Gestalt, in ihren körperlichen Ableitungen und geistigen Setzungen gleichermaßen begreifen. Am Ende der Zeitreise unten angekommen, steht man in der „Rennkurve“, die Spirale dreht sich in die Senkrechte, auf die letzten Silberpfeile folgen einige Prototypen der Zukunftstechnologien des Automobilbaus. Hier ist Schluss, wo es eigentlich weitergehen müsste – ins Licht, ins Freie, in die Zukunft –, dreht sich die Zeitreise ins Dunkle, in den Orkus. Eine Treppe geleitet hinab ins Souterrain mit den „Laboratorien“, wo man sich über aktuelle Entwicklungen im Hause Mercedes informieren kann. Diese Treppe führt noch einmal abschließend die Ambivalenz des Gebäudes vor Augen, wo so oft Gutes und Schlechtes unvermittelt nebeneinander stehen, wo die große Geste erst erstaunt und plötzlich im Banalen endet. Die Treppe musste wegen der großen Raumhöhe in mehrere Läufe aufgeteilt werden, aber der Architekt wollte hier nur eine einzige Schräge, statt eines Wechsels von Läufen und Podesten. Deshalb hat er sie zwischen gerade Wangen gelegt, die außen einen einfachen, schrägen Metallkasten bilden, der die Läufe und Podeste umhüllt. Innen ist sie aus grellrot gestrichenem Beton, dem die Handläufe als ausgehöhlte Griffleisten einmodelliert sind. Ein klassisches Architekturelement, sorgfältig detailliert und mit einem sehr bequemen Steigungsverhältnis von 154/34, diesmal auch handwerklich richtig, ist in einen Stahlcontainer verpackt. Dies ist eine witzige Idee, die den ironischen Umgang mit der klassischen Architektur, wie er durchweg im Hause manchmal zufällig, manchmal bewusst passiert, in einem einzigen Element wohlkalkuliert auf den Begriff bringt. Man sieht, hier versteht jemand durchaus die Kunst der architektonischen Pointe, aber dann endet diese Treppe unten viel zu dicht vor einer Bar, sozusagen im Sofa der Cafeteria. Dies ist nicht mehr witzig, sonder wieder ein Kunstfehler. Nihilismus oder Artenvielfalt? Am Ende stellt sich die Frage nach dem Architekturverständnis, das sich in diesem Bauwerk artikuliert. Gewiss ist das Mercedes-Benz-Museum konstruktiv und technisch eindrucksvoll, räumlich neuartig und ein wahres Wechselbad unterschiedlicher Erlebnisqualitäten, aber dies alles erhebt den Bau noch nicht zur Architektur. Von Architektur sprechen wir ja erst, wenn neben den praktischen Zwecken und ihrer Bewältigung in Form und Konstruktion auch die Inhalte zur Darstellung gebracht und in eine umfassendere Perspektive auf die Ordnung der Dinge einbezogen werden. Eben dies unterscheidet Architektur vom bloßen Bauen, das nur der optimierten Unterbringung notwendiger Zweckbestimmungen dient, während Architektur darüber hinaus sich selbst, ihre Aufgaben und die Rollen ihrer Nutzer im Ganzen der sichtbaren wie vorgestellten Welt darstellen und deuten will. Das Wegesystem eines Termitenhaufens ist räumlich und funktional weitaus komplexer als die Stuttgarter Doppelhelix, die Statik eines Spinngewebs im Verhältnis der eingesetzten Mittel unendlich effektiver als die hier bewunderten verdrehten Spiralen des Betontragwerks. Dennoch sprechen wir bei diesen erstaunlichen Naturschöpfungen der höhlen- und nestbauenden Tiere eben nicht oder nur im metaphorischen Sinne von Architektur, weil ihnen die reflektive darstellende und deutende Dimension fehlt, die allein erst das Bauen zu der Kunst erhebt, die wir Architektur nennen. Die ausgeklügeltste und die höchste räumliche Komplexität bleiben architektonisch irrelevant, wenn sie nicht in den Dienst einer architektonischen Idee genommen sind, die sich aus unserem kulturellen Fundus ohne weiteres selbst erklärt. Das Stammeln der Architektur Darstellung und Deutung setzt in der Architektur wie in allen Medien der Kommunikation eine gemeinsame Sprache mit einem verbindlich kodifizierten Vokabular voraus. Wenn jeder mit Syntax und Worten auf seine eigene subjektive Weise umgeht, ist eine Verständigung nicht mehr möglich, eine babylonische Verwirrung greift um sich. Ben van Berkel begründet die Leitidee des Museumsentwurfs, die von oben in spiralförmigen Windungen herabführende Erschließung mit der Topografie des Stuttgarter Kessels, „wo man immer oben ankommt und dann hinunterfährt“. Für die Doppelläufigkeit der Spiralen wird die Helixstruktur der DNA herangezogen, für die Rundungen des Baukörpers das Raumkontinuum des Neckartals und die Organik der Körperformen. Hier wird einem organhaften Retrodesign das Wort geredet, das noch weiter zurück will als der Historismus und Eklektizismus des 19. Jahrhunderts, das sich nicht mehr an den Formen und Stilen der historischen Architektur orientiert, sondern an vorhistorischen Gebilden aus Topografie und Körperwelten. Mit den Rückgriffen auf die Nano-Physiologie der Moleküle und Zellstrukturen verabschiedet es sich zudem aus der Anschaulichkeit des sinnlich Wahrnehmbaren und macht sich ganz architekturfremde mikroskopische Konzeptionen der Biologie zu eigen. Diese nur noch über den Kopf zu vermittelnden Modelle, die gewaltsam auf die Architektur projiziert werden, sind noch beliebiger als die rückwärtsgewandten Stilprojektionen des Eklektizismus, da diese immerhin noch von der Prämisse ausgingen, dass die historische Architektur für jede Bauaufgabe einen fertig entwickelten, nicht mehr zu übertreffenden Stil bereithielte. Von solchen immerhin nachvollziehbaren Begründungen ist bei diesem neuerlichen „anything goes“ nichts mehr geblieben als der unverdrossen rückwärtsgewandte Blick auf das Vorbild, das nunmehr im Urschlamm der Prähistorie gesucht wird. Aus der Sprache der Architektur wird so ein Rückfall in die Onomatopoetik der Urlaute, die zwar noch elementare Erregungen auszudrücken vermag, aber unfähig ist, auch nur einen einzigen Gedanken zu artikulieren. Konventionen: Der Abfall der Niederlande Die Architekten rühmen sich damit, dass es im Mercedes-Benz-Museum keine rechten Winkel gibt. „Alle Wände und Decken, Rampen und Stützen sind gewölbt oder in sich gedreht und gehen in fließenden Formen ineinander über... Es ist nicht einmal möglich, streng zwischen horizontalen und vertikalen Flächen zu trennen...“. Aus der kulturhistorischen Perspektive ist nicht nachzuvollziehen, warum darin eine architektonische Qualität gesehen werden soll. Der Beginn der Architektur zu Anfang der historischen Zeit fällt mit der Bevorzugung von Richtungen, Achsen, rechten Winkeln und Vertikalen zusammen. Schon in der Prähistorie hat man gebaut, aber eben noch ohne solche Scheidungen, mit denen der Mensch der frühen Hochkulturen seine Behausung aus dem Formenfluss der Natur herausgelöst hat, um sich eben damit und von da an als Kulturwesen zu charakterisieren. Seither wird Architektur als eine Kunst der räumlichen Ordnung definiert, die dem fließendem Raum und dem organischen Körper der natürlichen Welt ein geometrisches System entgegenhält, das aus der rationalen Reduktion auf die in der Natur an Raum und Körper beobachteten Hauptrichtungen entwickelt ist, eben aus Vertikalität, Horizontalität, Frontalität usw. Diese Ableitungen bilden die räumlichen Prämissen der Architektur, die das künstlerische Bauen aller Epochen als kulturelle Setzung akzeptiert hat, um daraus in unendlicher Abwandlung die immer neuen Themen der Zeit, die veränderten Vorstellungen von Leben und Wirtschaften, kurz: das sich ständig wandelnde Lebensgefühl architektonisch zu inszenieren. Das Ergebnis dieser unendlichen Metamorphose sind die epochenweise wechselnden Formen und Stile der Architektur von den frühen Hochkulturen des dritten vorchristlichen Jahrtausends bis heute, und ihr Wesen ist ein Zusammenspiel von Wechsel und Kontinuität, von immer Neuem und immer Gleichem. Beides ist gleichermaßen wichtig, da wir einerseits anthropologisch determinierte Wesen sind, deren körperliche, kognitive und emotionale Grundausstattung sich in historischen Zeiträumen nicht ändern kann, andererseits sich aber die materiellen und geistigen Grundlagen unserer Existenz ständig und in immer rasanteren Sprüngen verändern, worauf die Architektur selbstverständlich zu reagieren hat. Diese Grundtatsache aller architektonischen Kultur, das wohlbedachte Wechselspiel von überzeitlich Gegebenem und zeitbedingter Neuerung wird von einer Architektur wie der von Ben van Berkel schlicht ignoriert. Dies gilt nicht nur für die hektische Suche nach immer neuen Formen im Detail, für die Missachtung sinnvoller handwerklicher Regeln des Bemessens und Gestaltens, nicht nur für den rüden, von keines Gedankens Blässe angekränkelten Umgang mit den Gesten und Zeichen der Architekturikonologie, sondern auch für die wirklichen Elementarien der Architektur. Das System des architektonischen Raumes wird in dieser Kontorsionsarchitektur willkürlich gestört, deformiert oder regressiv ins Organische zurückgeführt. An die Stelle von Ähnlichkeiten im Unähnlichen, die alle klassische Architektur herzustellen sucht, tritt mit den zoomorphen und organischen Formen eine Wortwörtlichkeit, in der sich der Mensch nur noch als Körper, aber nicht mehr als Geist wiederfinden kann. Es ist der „Sinn für Perpendikel und Wasserwaage“, der, wie Goethe sagt, die Architektur ausmacht, und der in den beliebigen Verdrehungen dieser Räume und in der alptraumhaften Wahnwelt eines Walfischbauchs in uns zerrissen und gequält wird. Diese Architektur spielt um des schnellen Effekts willen leichtfertig mit solch grundlegenden Wahrnehmungstatsachen – wie Geisterbahn, Disney World und Phantasialand oder die Filmkulissen einer Fantasy-Produktion. Dort haben derartige Effekte ihre Ort, aber ob sie angemessen sind, die Kulturgeschichte eines der wichtigsten Zeugnisse der modernen Welt – zu dessen Verständnis, Deutung oder Überhöhung sie nicht das Geringste beitragen – architektonisch zu inszenieren, muss doch höchst fragwürdig bleiben. Im Doktor Faustus erzählt Thomas Mann die tragische Geschichte des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, der die Musik ganz neu erfinden wollte, anstatt ihr im eigenen Werk neue, der Zeit gemäße Wege zu eröffnen. Als er dabei mit seiner „Apocalipsis cum figuris“ im Glissando endet und damit die Tonordnung aufgibt, die doch „die Befreiung der Musik aus dem Urzustande des durch die Stufen gezogenen Heulens“ war, stellt sich der Chronist dieser Tragödie die Frage, die sich auch hier aufdrängt: „Was aber aufhört, mit seiner Definition übereinzustimmen, hört das nicht überhaupt auf?“ Bauherr: Daimler Chrysler AG, Stuttgart * Quelle der Erstveröffentlichung: Baumeister – Zeitschrift für Architektur, 103. Jahrgang, Juli 2006, Seite 38-53 Fotos:
Abbildung 4, 5 und 6 (im Original S. 46-47):
Abbildung 7, 8 und 9 (im Original S. 48-49):
Abbildung 10, 11, 12, 13 und 14 (im Original Seite 50-51):
Abbildung 15, 16, 17 und 18 (im Original Seite 52-53):
|
|
| |
||
|
|
||